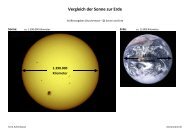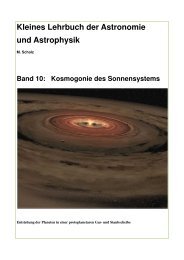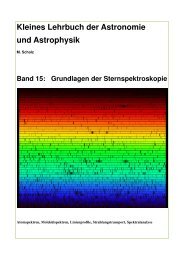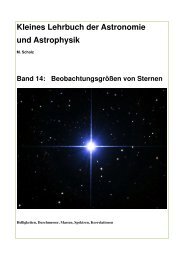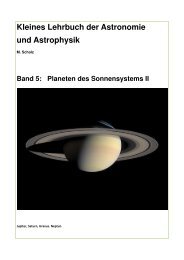Kleines Lehrbuch der Astronomie und Astrophysik - Astronomie.de
Kleines Lehrbuch der Astronomie und Astrophysik - Astronomie.de
Kleines Lehrbuch der Astronomie und Astrophysik - Astronomie.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Astronomie</strong> im optischen <strong>und</strong> infraroten Spektralbereich<br />
es durch <strong>de</strong>n Potentialabfall in <strong><strong>de</strong>r</strong> Depletionszone räumlich getrennt wird. Auf diese Weise sammeln<br />
sich im Bereich <strong>de</strong>s Pixels Ladungen an. Dieser Effekt läßt sich verstärken, wenn man auf <strong>de</strong>n p-<br />
Halbleiter eine nur Bruchteile eines Mikrometers dicke Isolatorschicht aufbringt <strong>und</strong> darauf eine<br />
Metallelektro<strong>de</strong> setzt („Gate“). Gewöhnlich verwen<strong>de</strong>t man als Substrat p-dotiertes Silizium <strong>und</strong> als<br />
Isolationsschicht Siliziumdioxid ( SiO 2 ). Legt man nun am Gate eine positive Spannung an, dann<br />
sammeln sich die durch <strong>de</strong>n inneren Fotoeffekt erzeugten freien Elektronen im Bereich <strong><strong>de</strong>r</strong> Substrat-<br />
Isolator-Grenze an, während die Löcher in das Innere <strong>de</strong>s Halbleitermaterials abgedrängt wer<strong>de</strong>n. Auf<br />
diese Weise entsteht ein Potentialtopf, <strong><strong>de</strong>r</strong> sich mit Ladungsträgern füllen läßt. Eine Raumladungszone<br />
verhin<strong><strong>de</strong>r</strong>t die Rekombination <strong><strong>de</strong>r</strong> darin enthaltenen Elektronen mit <strong>de</strong>n Löchern. Jetzt braucht diese<br />
während <strong><strong>de</strong>r</strong> Lichteinwirkung angesammelte Ladung nur noch in eine Spannung umgewan<strong>de</strong>lt <strong>und</strong> auf<br />
eine geeignete Art <strong>und</strong> Weise ausgelesen zu wer<strong>de</strong>n. Ein Problem dabei ist, das im Bereich <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Raumladungszone natürlich auch thermische Elektronen-Loch-Paare entstehen. Diese Elektronen<br />
wer<strong>de</strong>n natürlich auch im Potentialtopf gefangen. Bei Zimmertemperatur ist dieser Dunkelstrom so<br />
groß, daß die CCD innerhalb weniger Dutzend Sek<strong>und</strong>en bereits ihren Sättigungszustand erreicht.<br />
Deshalb sind bei han<strong>de</strong>lsüblichen Digitalkameras auch keine langen Belichtungszeiten möglich.<br />
Astronomisch brauchbare CCD-Arrays wer<strong>de</strong>n aus diesem Gr<strong>und</strong> gewöhnlich mit flüssigem Stickstoff<br />
gekühlt, um das thermische Rauschen zu unterdrücken. Amateur-CCD’s besitzen zumin<strong>de</strong>st ein<br />
Peltier-Element, um <strong>de</strong>n Chip bis zu 40° unter die Umgebungstemperatur zu kühlen.<br />
Ein aktives Element besteht aus drei <strong><strong>de</strong>r</strong> beschriebenen MOS-„Kon<strong>de</strong>nsatoren“, viele davon bil<strong>de</strong>n<br />
eine CCD-Zeile <strong>und</strong> viele Zeilen wie<strong><strong>de</strong>r</strong>um die lichtempfindliche Fläche <strong>de</strong>s Detektors. Während <strong>de</strong>s<br />
Belichtungsvorgangs in <strong><strong>de</strong>r</strong> CCD-Kamera wird an das Gate <strong><strong>de</strong>r</strong> mittleren MOS-Struktur eine kleine<br />
positive Spannung angelegt. Die Gates <strong><strong>de</strong>r</strong> benachbarten MOS-Strukturen wer<strong>de</strong>n dagegen auf einer<br />
niedrigeren Spannung gehalten (z.B. 0 V). Auf diese Weise wird eine Potentialbarriere aufgebaut,<br />
welche die aktiven, d.h. ladungssammeln<strong>de</strong>n MOS-Strukturen durch jeweils zwei Elektro<strong>de</strong>n von ihren<br />
aktiven Nachbarn trennt. In<strong>de</strong>m man nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Belichtung die Potentiale dieser Gates in einem<br />
bestimmten Regime än<strong><strong>de</strong>r</strong>t (Multiplexbetrieb, „charge coupling“), kann man erreichen, daß die<br />
gesammelten Ladungen von Element zu Element verschoben wer<strong>de</strong>n, bis sie am Rand <strong><strong>de</strong>r</strong> CCD-Zeile<br />
angelangt sind. Dort befin<strong>de</strong>t sich die sogenannte Auslesespalte. Sie unterschei<strong>de</strong>t sich von einer<br />
normalen CCD-Spalte nur dahingehend, daß in ihr die Ladungen rechtwinklig zur bisherigen Richtung<br />
bewegt wer<strong>de</strong>n. Das letzte Element dieser Spalte ist schließlich mit einem Analog-Digital-Wandler<br />
verb<strong>und</strong>en, welcher die Größe <strong><strong>de</strong>r</strong> in diesem Pixel angesammelten Ladung digitalisiert, damit sie von<br />
einem Computer bearbeitet wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Die Auslesezeit ist ein wichtiger technischer Parameter. Sie muß so ausgelegt wer<strong>de</strong>n, daß das auf <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
CCD gespeicherte Ladungsmuster beim Lesevorgang nicht verwischt wird.<br />
Das Ergebnis einer CCD-Aufnahme ist vom Prinzip her nichts weiter als eine Tabelle, die genauso<br />
viele Zeilen enthält wie die CCD Pixel hat. Dabei ist je<strong>de</strong>m Pixelin<strong>de</strong>x eine ganze Zahl zugeordnet, die<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> angesammelten Ladung in <strong>de</strong>m entsprechen<strong>de</strong>n CCD-Element proportional ist. Der Wertebereich<br />
dieser Zahlen hängt vom Auflösungsvermögen <strong>de</strong>s verwen<strong>de</strong>ten Analog-Digitalwandlers ab. Er<br />
bestimmt im Wesentlichen auch die Dynamik <strong><strong>de</strong>r</strong> CCD-Kamera (genauer, <strong><strong>de</strong>r</strong>en „Bildtiefe“). Eine<br />
Auflösung von 12 Bit liefert <strong>de</strong>mnach einen Wertebereich von<br />
29<br />
12<br />
2 ={0..4095}. Eine Auflösung von 2