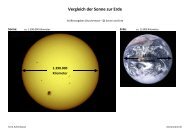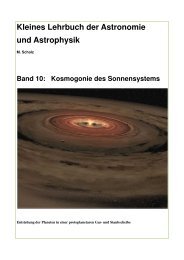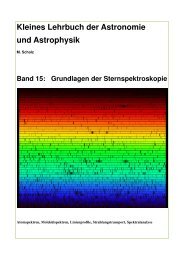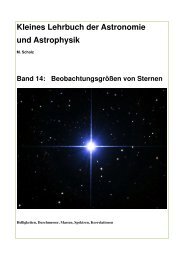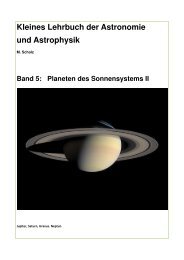Kleines Lehrbuch der Astronomie und Astrophysik - Astronomie.de
Kleines Lehrbuch der Astronomie und Astrophysik - Astronomie.de
Kleines Lehrbuch der Astronomie und Astrophysik - Astronomie.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Astronomie</strong> im kurzwelligen Spektralbereich<br />
UV-<strong>Astronomie</strong><br />
Für die Ultraviolettastronomie können normale Spiegelteleskope, soweit sie zusätzlich keine<br />
abbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Glasoptiken benutzen, eingesetzt wer<strong>de</strong>n (Glas blockiert alle Wellenlängen unter 330 nm).<br />
Als Strahlungs<strong>de</strong>tektoren kommen Fotoplatten <strong>und</strong> modifizierte Festkörper<strong>de</strong>tektoren (CCD`s) zum<br />
Einsatz. Ein kleiner Teil (ca.100 nm) <strong>de</strong>s Spektrums, <strong><strong>de</strong>r</strong> sich an das Violett (U) anschließt, ist auch<br />
von <strong><strong>de</strong>r</strong> Erdoberfläche aus noch zugänglich. Ab 300 nm setzt jedoch die sehr effektive Ozon-<br />
Absorption ein, die man nur durch satellitengestützte Beobachtungen umgehen kann. Ab einer<br />
Wellenlänge von ca. 90 nm treten auch dort Schwierigkeiten auf, da bei λ < 91.2 nm das sogenannte<br />
Lyman-Kontinuum beginnt. Ab dieser Grenze wer<strong>de</strong>n die UV-Quanten durch das neutrale<br />
Wasserstoffgas <strong>de</strong>s interstellaren Mediums wirksam absorbiert, welches dann in <strong>de</strong>n einfach ionisierten<br />
Zustand übergeht. Durch diesen „interstellaren Nebel“ wird bis hinunter zu etwa λ = 10 nm <strong><strong>de</strong>r</strong> Blick<br />
in <strong>de</strong>n kosmischen Raums weitgehend verschleiert. Deshalb sind Beobachtungen im EUV auf<br />
kosmische Objekte begrenzt, die sich in <strong><strong>de</strong>r</strong> unmittelbaren Umgebung <strong><strong>de</strong>r</strong> Sonne befin<strong>de</strong>n (d.h. bis<br />
Entfernungen von max. 100 pc). Die Sonne selbst ist in diesem Spektralbereich übrigens ein überaus<br />
dankbares Objekt.<br />
Die ersten Versuche, kosmische UV-Strahlung nachzuweisen, erfolgten mit Hilfe von<br />
Stratosphärenballons (ab 1957, Stratoscope I <strong>und</strong> II) <strong>und</strong> mittels ballistischer Raketen. Das bevorzugte<br />
Untersuchungsobjekt war dabei die Sonne. En<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> 60-ziger Jahre begann man verstärkt künstliche<br />
Erdsatelliten mit Equipment auszustatten, die eine Beobachtung kosmischer UV-Strahlungsquellen<br />
erlaubte. Ein beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s erfolgreiches Unternehmen war OAO-3 („Orbiting Astronomical<br />
Observatory“), welches 1972 in eine Erdumlaufbahn gelangte <strong>und</strong> ein Jahr später <strong>de</strong>n Namen<br />
„Copernicus“ erhielt. Damit begann übrigens die Tradition, beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s leistungsfähige astronomische<br />
Beobachtungssatelliten nach berühmten Astronomen zu benennen.<br />
Die bei weitem erfolgreichste Beobachtungskampagne im ultravioletten Spektralbereich wur<strong>de</strong><br />
zweifellos mit <strong>de</strong>m „International Ultraviolet Explorer“ (IUE) durchgeführt. Dieser Satellit, <strong><strong>de</strong>r</strong> mit<br />
zwei Spektrographen unterschiedlicher Auflösung für <strong>de</strong>n Wellenlängenbereich von 330 nm bis 115<br />
nm ausgestattet war, wur<strong>de</strong> am 26. Januar 1978 gestartet. Er war eigentlich für einen zwei- bis<br />
dreijährigen Einsatz konzipiert. Letztlich vergingen aber 18.7 Jahre ununterbrochener Betrieb, bis er<br />
1996 endgültig abgeschaltet wur<strong>de</strong> (nicht weil die Beobachtungsobjekte ausgegangen sind, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n –<br />
wie so oft im Leben – wegen Geldmangel). Zu seiner Erfolgsbilanz gehören 110000 UV-Spektren von<br />
mehr als 11000 Objekten, die über das astronomische Recherchesystem INES („IUE Newly Extracted<br />
Spectra“) allen Astronomen über das Internet weltweit für ihre Forschungen zur Verfügung stehen.<br />
Weitere Höhepunkte in <strong><strong>de</strong>r</strong> UV-<strong>Astronomie</strong> waren u.a. die Shuttle-Missionen STS51 (Discovery, Start<br />
12.9.1993) <strong>und</strong> STS80 (Columbia, Start 19.11.1996), bei <strong>de</strong>m <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>utsche Forschungssatellit ASTRO-<br />
SPAS zum Einsatz kam. Auf ihm war das UV-Teleskop ORFEUS („Orbiting and Retrievable Far and<br />
Extrem Ultraviolet Spectrometer“) <strong><strong>de</strong>r</strong> Universität Tübingen montiert, mit <strong>de</strong>m während <strong><strong>de</strong>r</strong> Missionen<br />
mit Hilfe eines speziellen Echelle-Gitterspektrographen hochaufgelöste UV-Spektren (Meßbereich 140<br />
nm bis 90 nm) von verschie<strong>de</strong>nen Himmelskörpern aufgenommen wer<strong>de</strong>n konnten. Als Detektor<br />
wur<strong>de</strong> eine Kombination aus einer sogenannten Mikrokanalplatte <strong>und</strong> einer Keilstreifenano<strong>de</strong><br />
verwen<strong>de</strong>t. Einfach gesprochen, besteht eine Mikrokanalplatte aus vielen winzig kleinen SEV-Röhren,<br />
55