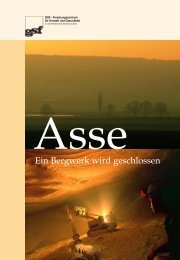PDF, 15 MB, Datei ist nicht barrierefrei - Asse II
PDF, 15 MB, Datei ist nicht barrierefrei - Asse II
PDF, 15 MB, Datei ist nicht barrierefrei - Asse II
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
B IfG 19/2003 Rev. 02<br />
Tragfähigkeitsanalyse des Gesamtsystems der Schachtanlage <strong>Asse</strong><br />
in der Betriebsphase<br />
104<br />
oberhalb des Pumpversatzes liegende Schwebe (Schwebenreste) von unten gestützt. Der<br />
die Kammern weitgehend ausfüllende Blasversatz wird durch diese Maßnahme <strong>nicht</strong><br />
entscheidend ertüchtigt, d.h. es sind keine wesentlich erhöhten Widerstände des<br />
Versatzkörpers während der Lösungseinleitung zu erwarten.<br />
Bei selektivem Nachversetzen der Resthohlräume mit einem Pumpversatz sollte technisch<br />
sichergestellt werden, dass die zur Gewährle<strong>ist</strong>ung der Pumpfähigkeit verwendete<br />
Salzlösung im Versatz verbleibt und <strong>nicht</strong> in die Pfeiler eindringen kann.<br />
Aus gebirgsmechanischer Sicht <strong>ist</strong> festzustellen, dass allein durch Verpumpen von<br />
Resthohlräumen (Firstspalten, Zwickel) das Qualitätsziel <strong>nicht</strong> zu erreichen <strong>ist</strong>. Wenn keine<br />
gebirgsmechanische Schädigung durch ein Feuchtekriechen oder zusätzliche<br />
Bruchprozesse initiiert werden, besitzt der Pumpversatz in der Kombination mit der obigen<br />
Maßnahme jedoch eine positive Wirkung.<br />
Eine Verdopplung der Einleitrate auf 3000 m³/d und eine damit verbundenen Verkürzung der<br />
Einleitungszeit um ein Jahr bringt hinsichtlich der Deckgebirgsverschiebungen keine<br />
nennenswerten Verbesserungen und wird infolge der sich schneller akkumulierenden<br />
Spannungen und daraus resultierenden Konvergenzsprünge <strong>nicht</strong> empfohlen.<br />
9.4 Überprüfung der erhöhten Deckgebirgsverschiebungsraten ohne pneumatischen<br />
Stützdruck<br />
In einem abschließenden Untersuchungsschritt wurde wieder auf das schon im Kapitel 8.3<br />
verwendete 3D-Modell der 511- bis 574-m-Sohle zurückgegriffen. Mit diesem Modell besteht<br />
die Untersuchungsmöglichkeit der gebirgsmechanischen Reaktionen der Pfeiler und<br />
Schweben im Verformungsmaximum der Südflanke, während die gebirgsmechanischen<br />
Reaktionen im Deckgebirge infolge der Belastungsumverlagerungen <strong>nicht</strong> abgebildet werden<br />
können. Es <strong>ist</strong> lediglich möglich, mit unterschiedlichen Deckgebirgsverschiebungsraten<br />
dessen Reaktivität zu simulieren. Es soll jetzt überprüft werden, ob die im 2D-Modell ohne<br />
pneumatischen Stützdruck berechnete maximale Erhöhung der Deckgebirgsverschiebungsraten<br />
bis zu 1 m/a zum Zeitpunkt der Schutzfluideinleitung auch im 3D-Modell<br />
ermittelt wird. Mit dem Modell soll das integrale Systemverhalten bis zum Ende der<br />
Betriebsphase untersucht werden, wobei keine Wechselwirkung mit dem Deckgebirge<br />
erfolgt, d.h., die Verschiebungsrate bleibt unbeeinflusst. In dem 3D-Modell <strong>ist</strong> neben der<br />
Versatzdruckwirkung in Höhe des Eigengewichtes gleichfalls das komplexe Stoffverhalten<br />
des Steinsalzes unter den gegebenen Standortbedingungen, bestehend aus den<br />
skleronomen Anteilen mit Modellierung der Entfestigung und Dilatanz und den rheonomen<br />
Institut für Gebirgsmechanik GmbH Leipzig; Friederikenstraße 60; 04279 Leipzig; Tel/(Fax): 0341/33600-(0/308)