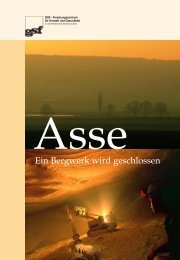PDF, 15 MB, Datei ist nicht barrierefrei - Asse II
PDF, 15 MB, Datei ist nicht barrierefrei - Asse II
PDF, 15 MB, Datei ist nicht barrierefrei - Asse II
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
B IfG 19/2003 Rev. 02<br />
Tragfähigkeitsanalyse des Gesamtsystems der Schachtanlage <strong>Asse</strong><br />
in der Betriebsphase<br />
85<br />
Zur Klärung, ob gebirgsmechanische Vorgänge im Abbauhorizont, wie das in situ<br />
beobachtete Versagen der Schweben, ausreichen, um das gemessene<br />
Verschiebungsverhalten nachzubilden, wurde in [6] eine Voruntersuchung durchgeführt, in<br />
der ab dem Jahr 1983 die Schwebenbrüche im Modell durch Löschen der entsprechenden<br />
Elemente vorgegeben wurden. Im Ergebnis dieser Berechnung ergibt sich zwar eine<br />
Zunahme der Pfeilerstauchung, die aber durch eine größere Verschiebungsgeschwindigkeit<br />
des Nordstoßes gekennzeichnet <strong>ist</strong>. Das widerspricht dem In-situ-Beobachtungsbefund mit<br />
einer überwiegenden Verschiebungskomponente aus Süden. Mitte der 80er Jahre trat <strong>nicht</strong><br />
nur eine Konvergenzbeschleunigung ein, gleichzeitig kam der Hauptanteil der<br />
Verschiebungen <strong>nicht</strong> mehr aus Norden, sondern wurde durch die Verschiebung des<br />
südlichen Deckgebirges beigetragen. Die Verschiebungsbeschleunigung <strong>ist</strong> demzufolge aus<br />
dem Versagen der Schweben allein <strong>nicht</strong> zu erklären.<br />
Die Dominanz des Verschiebungsanteils aus südlicher Richtung <strong>ist</strong> nur mit<br />
Festigkeitsüberschreitungen und daraus folgenden plastischen Deformationen im<br />
Deckgebirge zu begründen. Ohne eine solche Simulation würden die Kriechdeformationen<br />
im Carnallitit und Steinsalz des Sattelkerns überwiegen. Ab Mitte der 80er Jahre entstanden<br />
im Deckgebirge Bruch- und Scherzonen, in denen Flüssigkeitsdrücke mechanisch wirksam<br />
wurden. Mit fortschreitender Konvergenz des Abbausystems an der Südflanke weiteten sich<br />
diese Bruch- und Scherzonen aus, so dass der Fluiddruck in zunehmendem Maße die<br />
Eigentragfähigkeit des Deckgebirges verringerte und zu einer zusätzlichen Belastung der<br />
Tragelemente im Tragsystem an der Südflanke führte. Im Ergebnis umfangreicher<br />
Fallstudien wurde damit ein physikalisch plausibles Modell zur Nachbildung der<br />
Standortdaten gefunden.<br />
In den Anlagen 60 und 61 sind die Scherdeformationen im Deckgebirge und Grubengebäude<br />
sowie die mit einem Fluiddruck beaufschlagten Deckgebirgsbereiche im Jahr 2004<br />
dargestellt. In Anlage 60 <strong>ist</strong> zu erkennen, dass die erhöhten Scherdeformationen im<br />
Deckgebirge (Scherdeformationen > 12 %) eine Gleitfläche mit Gewölbewirkung über dem<br />
Steinsalzfeld der Südflanke ausweisen. Die auftretenden Scherdeformationen im Oberen<br />
Buntsandstein (insbesondere im Rötanhydrit) und an der Schichtgrenze zum Unteren<br />
Muschelkalk begründen entsprechend der dargelegten Modellierung die in Anlage 61<br />
gezeigten lokalen Initialisierungen von hydraulischen Drücken mit unterschiedlichen<br />
Wirkfaktoren. Es <strong>ist</strong> bemerkenswert, dass die angelegten tektonischen Trennflächen der<br />
Großklüfte die Scherbänder nur unwesentlich in ihrer Lage beeinflussen. Die Lage der<br />
Scherbänder wird vorrangig vom Verschiebungsfeld in Hohlraumrichtung und den daraus<br />
resultierenden Festigkeitsüberschreitungen verursacht.<br />
Institut für Gebirgsmechanik GmbH Leipzig; Friederikenstraße 60; 04279 Leipzig; Tel/(Fax): 0341/33600-(0/308)