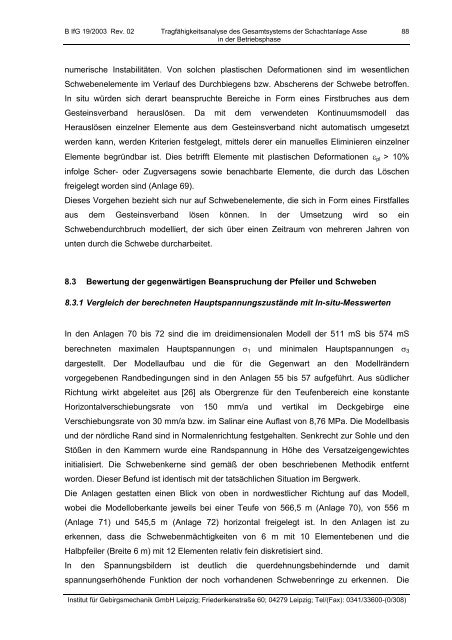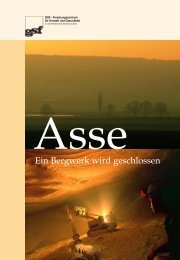PDF, 15 MB, Datei ist nicht barrierefrei - Asse II
PDF, 15 MB, Datei ist nicht barrierefrei - Asse II
PDF, 15 MB, Datei ist nicht barrierefrei - Asse II
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
B IfG 19/2003 Rev. 02<br />
Tragfähigkeitsanalyse des Gesamtsystems der Schachtanlage <strong>Asse</strong><br />
in der Betriebsphase<br />
88<br />
numerische Instabilitäten. Von solchen plastischen Deformationen sind im wesentlichen<br />
Schwebenelemente im Verlauf des Durchbiegens bzw. Abscherens der Schwebe betroffen.<br />
In situ würden sich derart beanspruchte Bereiche in Form eines Firstbruches aus dem<br />
Gesteinsverband herauslösen. Da mit dem verwendeten Kontinuumsmodell das<br />
Herauslösen einzelner Elemente aus dem Gesteinsverband <strong>nicht</strong> automatisch umgesetzt<br />
werden kann, werden Kriterien festgelegt, mittels derer ein manuelles Eliminieren einzelner<br />
Elemente begründbar <strong>ist</strong>. Dies betrifft Elemente mit plastischen Deformationen ε pl > 10%<br />
infolge Scher- oder Zugversagens sowie benachbarte Elemente, die durch das Löschen<br />
freigelegt worden sind (Anlage 69).<br />
Dieses Vorgehen bezieht sich nur auf Schwebenelemente, die sich in Form eines Firstfalles<br />
aus dem Gesteinsverband lösen können. In der Umsetzung wird so ein<br />
Schwebendurchbruch modelliert, der sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren von<br />
unten durch die Schwebe durcharbeitet.<br />
8.3 Bewertung der gegenwärtigen Beanspruchung der Pfeiler und Schweben<br />
8.3.1 Vergleich der berechneten Hauptspannungszustände mit In-situ-Messwerten<br />
In den Anlagen 70 bis 72 sind die im dreidimensionalen Modell der 511 mS bis 574 mS<br />
berechneten maximalen Hauptspannungen σ 1 und minimalen Hauptspannungen σ 3<br />
dargestellt. Der Modellaufbau und die für die Gegenwart an den Modellrändern<br />
vorgegebenen Randbedingungen sind in den Anlagen 55 bis 57 aufgeführt. Aus südlicher<br />
Richtung wirkt abgeleitet aus [26] als Obergrenze für den Teufenbereich eine konstante<br />
Horizontalverschiebungsrate von <strong>15</strong>0 mm/a und vertikal im Deckgebirge eine<br />
Verschiebungsrate von 30 mm/a bzw. im Salinar eine Auflast von 8,76 MPa. Die Modellbasis<br />
und der nördliche Rand sind in Normalenrichtung festgehalten. Senkrecht zur Sohle und den<br />
Stößen in den Kammern wurde eine Randspannung in Höhe des Versatzeigengewichtes<br />
initialisiert. Die Schwebenkerne sind gemäß der oben beschriebenen Methodik entfernt<br />
worden. Dieser Befund <strong>ist</strong> identisch mit der tatsächlichen Situation im Bergwerk.<br />
Die Anlagen gestatten einen Blick von oben in nordwestlicher Richtung auf das Modell,<br />
wobei die Modelloberkante jeweils bei einer Teufe von 566,5 m (Anlage 70), von 556 m<br />
(Anlage 71) und 545,5 m (Anlage 72) horizontal freigelegt <strong>ist</strong>. In den Anlagen <strong>ist</strong> zu<br />
erkennen, dass die Schwebenmächtigkeiten von 6 m mit 10 Elementebenen und die<br />
Halbpfeiler (Breite 6 m) mit 12 Elementen relativ fein diskretisiert sind.<br />
In den Spannungsbildern <strong>ist</strong> deutlich die querdehnungsbehindernde und damit<br />
spannungserhöhende Funktion der noch vorhandenen Schwebenringe zu erkennen. Die<br />
Institut für Gebirgsmechanik GmbH Leipzig; Friederikenstraße 60; 04279 Leipzig; Tel/(Fax): 0341/33600-(0/308)