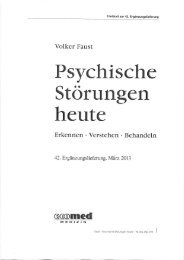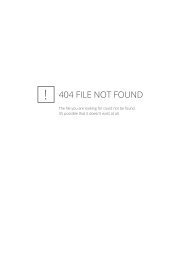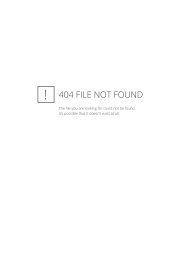parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 25 -<br />
Schon hier bzw. besonders bei der Mimik aber muss auf etwas hingewiesen<br />
werden, dass den Betroffenen fast noch mehr zu schaffen macht als die äußeren<br />
Beeinträchtigungen. Die Rede ist von der irrtümlichen Annahme vor allem<br />
fremder Gesprächspartner, es handele sich um eine geistige Leistungseinbuße.<br />
Dabei kann man der näheren und weiteren Umgebung diesen<br />
falschen Eindruck nicht einmal verargen. Schließlich hängt die Beurteilung der<br />
geistigen Fähigkeiten nicht zuletzt vom äußeren Eindruck ab, insbesondere<br />
von der (Lebhaftigkeit der) Mimik. Über die intellektuelle Ausgangslage eines<br />
bisher Unbekannten machen wir uns schon ein Bild, bevor dieser den Mund<br />
aufgemacht hat und uns damit gezielter wissen lässt, „wes Geistes Kind er<br />
ist“.<br />
Das heißt: Die Einschränkung der persönlichen Ausdrucksfähigkeit hinterlässt<br />
bei zumindest fremden Gesprächspartnern den Eindruck eines geistigen Defizits<br />
– seit jeher oder eben erst später erworben. Dagegen kann der Betroffene<br />
– obwohl er es spürt und vor allem fürchtet – erst einmal gar nichts tun. Er gerät<br />
unverschuldet in die missliche Lage, intellektuell abgestempelt zu werden,<br />
bevor er überhaupt beweisen kann, dass das nicht stimmt.<br />
Die Therapeuten empfehlen deshalb den Parkinson-Patienten und nicht<br />
zuletzt ihren Angehörigen in solchen Situationen ruhig, sachlich und<br />
konsequent einfließen zu lassen, dass hier eine „leichte Schwäche der<br />
Gesichtsmuskulatur“ vorliegt, damit sich der andere kein falsches Bild macht.<br />
Ob es darüber hinaus sinnvoll ist, gleich die Behinderung als solche<br />
anzusprechen (Parkinson-Krankheit, bei der ja bekanntlich auch das<br />
Minenspiel beeinträchtigt ist), bleibt dem Einzelfall überlassen (was im Übrigen<br />
für jede körperliche Behinderung gilt).<br />
Sprache und Sprechen<br />
Sprechstörungen sind unterteilbar in Aphonie und Dysphonie (Stimmlosigkeit,<br />
Heiserkeit, Hauchen), Dysarthrie (Störung der Artikulation, d. h. Lautbildung,<br />
deutliche Aussprache), in Stottern, Stammeln, Logoklonie (krampfhafte Silbenwiederholung)<br />
u.a.<br />
Störungen des Redens äußern sich in Veränderungen der Lautstärke, der<br />
Modulation (z. B. Tonfall), in verlangsamtem, stockendem, abgerissenem oder<br />
überhastet wirkendem Reden sowie in bestimmten krankhaften Formen wie<br />
Echolalie (echoartiges Wiederholen), Mutismus (Verstummen) u.a.<br />
Sprache und Sprechen sind also überaus komplizierte und für den zwischenmenschlichen<br />
Kontakt entscheidende Faktoren. Und auch hier ist der Parkinson-Kranke<br />
überaus hinderlich beeinträchtigt. Immerhin wird die Sprache erst<br />
im fortgeschrittenen Krankheitsstadium leiser, rauer und monotoner (Fach-<br />
Int.1-Parkinson.doc