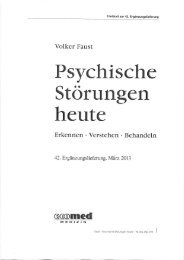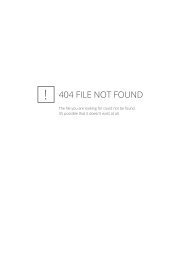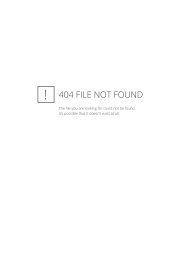parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 82 -<br />
Parkinson-Syndrom erfolgreich sind (z. B. L-Dopa (retard), Dopaminagonisten<br />
oder - 2. Wahl - Opiate, Benzodiazpine, Carbamazepin u.a).<br />
- Akathisie kommt vom griechischen und bezeichnet die Unfähigkeit zu<br />
sitzen. Wenn es nur das wäre. Es quält nicht nur eine erhebliche innere Unruhe<br />
mit dem Zwang zur ständigen Bewegung, die erst durch Umherlaufen<br />
gemildert wird, es droht auch eine lästige und nach und nach auffallende und<br />
damit stigmatisierende Geh- und Stehunruhe (Hin- und Herrutschen, Beine<br />
übereinander schlagen mit wippenden Bewegungen, Aufstehen, Hin- und Hergehen,<br />
Hinsetzen, manchmal sogar „stampfende“ Fußbewegungen u.a.).<br />
Dazu kommen Missempfindungen und brennende Schmerzen, meist im<br />
Bereich der Beine. Selbst so genannte Vokalisationen, also Lautäußerungen<br />
wie stöhnen, ächzen und brummen sind möglich.<br />
Die Akathisie wurde früher auch häufig mit einer Parkinson-Krankheit in Verbindung<br />
gebracht. Später registrierte man sie vor allem als belastende Nebenwirkung<br />
nach Behandlung mit hoch- und mittelpotenten Neuroleptika (antipsychotisch<br />
wirkende Psychopharmaka), und zwar bei Therapiebeginn als<br />
akute Akathisie und unter Langzeitbehandlung als so genannte tardive Akathisie<br />
(mit sehr begrenzten Behandlungs- bzw. wenigstens Linderungsmöglichkeiten).<br />
Heute findet sich die Akathisie vor allem im Rahmen eines medikamentös ausgelösten<br />
Parkinson-Syndroms (medikamentöses Parkinsonoid – siehe<br />
dieses). Die Behandlung besteht in dieser wenigstens günstigen Form im<br />
Absetzen des auslösenden Arzneimittels – sofern möglich. Lindernd werden<br />
auch bestimmte weitere Arzneimittel versucht (siehe Fachliteratur).<br />
APPARATIVE DIAGNOSTIK DER PARKINSON-KRANKHEIT<br />
Die Diagnose einer Parkinson-Krankheit ist klinisch zu stellen, d. h. durch eine<br />
gezielte Exploration (Befragung) von Patient und Angehörigen sowie eine<br />
fachärztliche (neurologische) Untersuchung.<br />
Aparative Zusatz-Untersuchungen sind zwar hilfreich, können aber den fachärztlichen<br />
Befund weder beweisen noch ausschließen. Sie sind aber wichtige<br />
zusätzliche Informationen, insbesondere was die Einschätzung des weiteren<br />
Verlaufs und eine Abgrenzung gegenüber anderen Krankheitsbildern anbelangt,<br />
die ähnliche Beschwerden machen können (Fachbegriff: Differentialdiagnose).<br />
Die wichtigsten derzeit verfügbaren apparativen Methoden sind: Elektroenzephalogramm<br />
- EEG/Hirnstrombild, visuell, akustisch und motorisch evozierte<br />
Int.1-Parkinson.doc