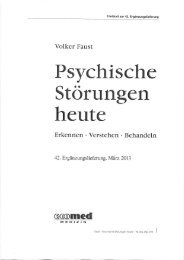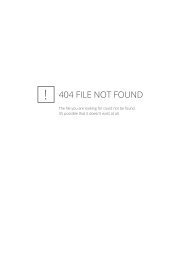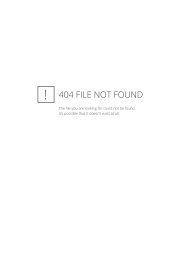parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 61 -<br />
Zittern bereits wieder vor dem Erwachen auftreten und damit das Aufwachen<br />
geradezu provozieren.<br />
Und schließlich sind es die ängstlich-depressiven Zustände, die den Parkinson-Kranken<br />
zermürben, quälen, in Furcht und Schrecken versetzen. Dies insbesondere<br />
beim nächtlichen Wachliegen, oder nach dem Aufwachen, nachts<br />
oder am Morgen. Das kennt zwar jeder von sich selber, wer hat nicht schon<br />
nächteweise gegrübelt, aber in der Regel schläft man wieder ein und kann<br />
sich deshalb kaum mehr daran erinnern. Depressive im allgemeinen und<br />
Parkinson-Depressive im speziellen werden durch ihre Stimmungstiefs und<br />
vielfältigen Befürchtungen so verunsichert, dass sie überhaupt keinen Schlaf<br />
mehr finden, eine besonders quälende Form des nächtlichen Problem-<br />
Grübelns.<br />
Die Therapie einer Schlafstörung für ansonsten Gesunde gliedert sich in Arzneimittel<br />
und nicht-medikamentöse Maßnahmen. Einzelheiten dazu siehe das spezielle Kapitel<br />
über die Schlafstörungen. Dort geht es auch um die Schlafhygiene, schlafstörende<br />
und -fördernde Verhaltensweisen, ja um die richtige Lebensweise (der Tag<br />
entscheidet mehr über die Nacht, als sich die meisten eingestehen), um den sinnvollen<br />
Einsatz von Mittagsschlaf, körperlicher Aktivität, Mahlzeiten, Alkohol-, Kaffee-<br />
und Zigarettenkonsum sowie um Einschlaf-Rituale, die nicht nur für Kinder, auch für<br />
Erwachsene nützlich sind. Das Gleiche gilt für die Gestaltung des Schlafzimmers (wo<br />
man mehr Fehler machen kann, als den meisten bekannt sein dürfte), um den geregelten<br />
Schlaf-Wach-Rhythmus („innere Uhr“) und eine Vielzahl von äußeren<br />
Belastungen, vom Schnarchen des Partners bis zum Verkehrslärm.<br />
Was die medikamentösen Möglichkeiten bei der <strong>parkinson</strong>-bedingten Schlafstörung<br />
anbelangt, so müssen gerade hier Hausarzt und Neurologe eng zusammenarbeiten<br />
(Parkinson-Arzneimittel, Antidepressiva, schlaffördernde Neuroleptika oder Pflanzenheilmittel,<br />
synthetische („chemische“) Schlafmittel u.a.).<br />
� Schlaf-Apnoe-Syndrom<br />
Das Schlaf-Apnoe-Syndrom tritt gehäuft bei Männern in der mittleren Altersgruppe<br />
auf, verschont aber auch nicht das weibliche Geschlecht. Auffällig sind<br />
lautes Schnarchen, Bewegungsunruhe, schwere Erweckbarkeit und vor allem<br />
lange Atempausen. Letztere mehrmals in der Nacht und zwar über ungewöhnlich<br />
lange Zeit (d. h. mehr als 10 Sekunden, was für einen Atemstopp schon<br />
beunruhigend und vor allem nicht ungefährlich ist – s. u.).<br />
Ursache ist der Verschluss der oberen Atemwege, gelegentlich auch einmal<br />
eine zentrale (Gehirn-) Funktionsstörung. Die nächtlichen Atempausen führen<br />
nicht nur zu einem gestörten Schlafprofil, sondern durch die Sauerstoff-Unterbrechung<br />
bzw. damit ständige Unterversorgung zu riskanter Tagesmüdigkeit<br />
und Leistungsminderung bis hin zu ernsteren sonstigen Beeinträchtigungen.<br />
Int.1-Parkinson.doc