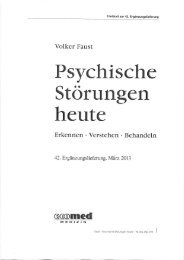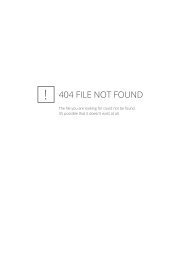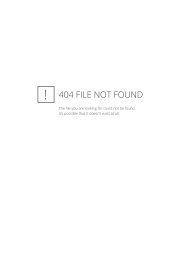parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
parkinson-krankheit - Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 99 -<br />
an einer chronisch fortschreitenden Erkrankung leidet, für die es – man muss<br />
es schon so direkt ausdrücken – derzeit (!) keine Heilung gibt. Umso wichtiger<br />
ist deshalb die Erkenntnis, dass es trotz dieser schmerzlichen Erkenntnis um<br />
ein Leiden mit in der Regel relativ gutartigem Krankheitsverlauf handelt. Und<br />
dass inzwischen überaus wirksame therapeutische Maßnahmen auf allen<br />
Ebenen zur Verfügung stehen, auf die man vor wenigen Jahrzehnten noch<br />
nicht zu hoffen wagte.<br />
Dennoch bleibt die Ungewissheit über die eigene, individuelle Krankheitsentwicklung<br />
bestehen. Und leider gibt es ja auch keine verlässlichen Parameter<br />
(Hilfsgrößen der Beurteilung einer Sachlage), die den weiteren Krankheitsverlauf<br />
halbwegs sicher voraussagen könnten.<br />
- Bekannt und entsprechend zu werten ist auch folgende Erkenntnis: Wer<br />
eine Diagnose mit vor allem psychosozial folgenschweren Konsequenzen hinnehmen<br />
muss, der wird plötzlich auf alles achten, was mit dieser Belastung in<br />
Zusammenhang gebracht werden kann, also alle Nachrichten in Presse,<br />
Rundfunk, Fernsehen, im Internet u.a. Und er wird darauf überaus sensibel<br />
reagieren, und zwar meist negativ („siehst du ...“). Da muss man kein Pessimist<br />
sein, um sich vor allem die negativen Seiten herauszufischen, entsprechende<br />
Befürchtungen zu nähren und damit einen Angst-Teufelskreis einzuleiten.<br />
Der Betroffene wird dieser Entwicklung kaum entgehen können, das ist<br />
eine schon fast normale Reaktion im Falle einer beginnenden bzw. diagnostisch<br />
gesicherten Krankheit.<br />
Hier sind deshalb die Angehörigen, die Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn<br />
u.a. gefordert, die sich ein wenig einlesen sollten, und zwar im positiven<br />
Sinne, um ermutigend auf den Patienten einzuwirken. Er wird es zwar kaum<br />
mit dem erwarteten Dank, nicht einmal mit größerer Erleichterung registrieren,<br />
da sollte man sich nicht täuschen. Vieles fällt aber doch auf fruchtbaren Boden<br />
und keimt schließlich im Rahmen einer erst langsam stabiler werdenden<br />
Einstellung mit konstruktiven Bewältigungs-Elementen. Oder kurz:<br />
„leidenschaftslos, aber beharrlich konstruktiv, ja optimistisch bleiben“.<br />
- Und was den Arbeitsplatz anbelangt, so muss man einen Mittelweg versuchen:<br />
Zum einen sollte man mögliche Leistungseinbußen nicht verbergen, so<br />
etwas heizt nur Gerüchte an. Im Gegenteil, man soll sowohl mit seinen Kollegen<br />
als auch Vorgesetzten über die Erkrankung sprechen, schließlich ist sie<br />
weder selten noch ehrenrührig. Am besten man schildert in einfachen Worten<br />
ihren Mechanismus, beispielsweise im Sinne unzureichend produzierter<br />
Botenstoffe im Gehirn, die die Bewegung steuern. Denn so etwas hört man<br />
immer öfter (z. B. bei Depressionen, Angststörungen, beim hyperaktiven<br />
Syndrom im Kindes- und Erwachsenenalter u.a.), das leuchtet ein und<br />
entspricht im Übrigen der Realität. Riskanter ist es hingegen von einem<br />
Zelluntergang bestimmter Hirnareale zu sprechen. Das legt immer die falsche<br />
Assoziation einer intellektuellen Störung nahe, Stichwort: Alzheimer-Demenz.<br />
Int.1-Parkinson.doc