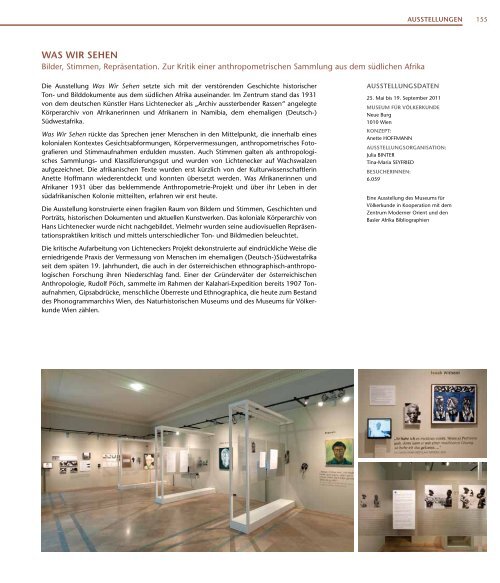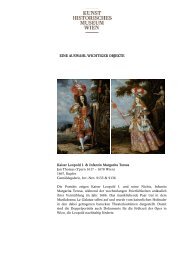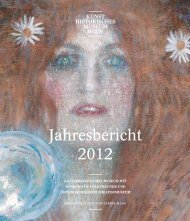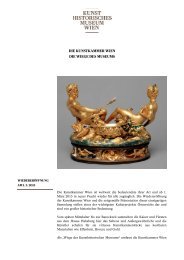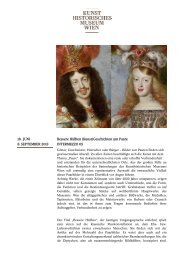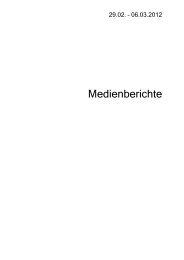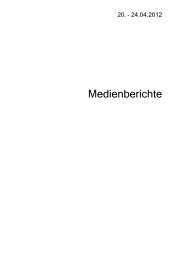Jahresbericht 2011 - Presse - Kunsthistorisches Museum Wien
Jahresbericht 2011 - Presse - Kunsthistorisches Museum Wien
Jahresbericht 2011 - Presse - Kunsthistorisches Museum Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
was wIr sehen<br />
Bilder, Stimmen, repräsentation. Zur Kritik einer anthropometrischen Sammlung aus dem südlichen Afrika<br />
Die Ausstellung Was Wir Sehen setzte sich mit der verstörenden Geschichte historischer<br />
Ton- und Bilddokumente aus dem südlichen Afrika auseinander. im Zentrum stand das 1931<br />
von dem deutschen Künstler Hans Lichtenecker als „Archiv aussterbender rassen“ angelegte<br />
Körperarchiv von Afrikanerinnen und Afrikanern in namibia, dem ehemaligen (Deutsch-)<br />
Südwestafrika.<br />
Was Wir Sehen rückte das Sprechen jener Menschen in den Mittelpunkt, die innerhalb eines<br />
kolonialen Kontextes Gesichtsabformungen, Körpervermessungen, anthropometrisches Fotografieren<br />
und Stimmaufnahmen erdulden mussten. Auch Stimmen galten als anthropologisches<br />
Sammlungs- und Klassifizierungsgut und wurden von Lichtenecker auf Wachswalzen<br />
aufgezeichnet. Die afrikanischen Texte wurden erst kürzlich von der Kulturwissenschaftlerin<br />
Anette Hoffmann wiederentdeckt und konnten übersetzt werden. Was Afrikanerinnen und<br />
Afrikaner 1931 über das beklemmende Anthropometrie-Projekt und über ihr Leben in der<br />
südafrikanischen Kolonie mitteilten, erfahren wir erst heute.<br />
Die Ausstellung konstruierte einen fragilen raum von Bildern und Stimmen, Geschichten und<br />
Porträts, historischen Dokumenten und aktuellen Kunstwerken. Das koloniale Körperarchiv von<br />
Hans Lichtenecker wurde nicht nachgebildet. Vielmehr wurden seine audiovisuellen repräsentationspraktiken<br />
kritisch und mittels unterschiedlicher Ton- und Bildmedien beleuchtet.<br />
Die kritische Aufarbeitung von Lichteneckers Projekt dekonstruierte auf eindrückliche Weise die<br />
erniedrigende Praxis der Vermessung von Menschen im ehemaligen (Deutsch-)Südwestafrika<br />
seit dem späten 19. Jahrhundert, die auch in der österreichischen ethnographisch-anthropologischen<br />
Forschung ihren niederschlag fand. einer der Gründerväter der österreichischen<br />
Anthropologie, rudolf Pöch, sammelte im rahmen der Kalahari-expedition bereits 1907 Tonaufnahmen,<br />
Gipsabdrücke, menschliche Überreste und ethnographica, die heute zum Bestand<br />
des Phonogrammarchivs <strong>Wien</strong>, des naturhistorischen <strong>Museum</strong>s und des <strong>Museum</strong>s für Völkerkunde<br />
<strong>Wien</strong> zählen.<br />
ausstellungsdaten<br />
ausstellungen 155<br />
25. Mai bis 19. September <strong>2011</strong><br />
museum FÜr VÖlkerkunde<br />
neue Burg<br />
1010 <strong>Wien</strong><br />
konzept:<br />
Anette HoFFMAnn<br />
ausstellungsorganIsatIon:<br />
Julia BinTer<br />
Tina-Maria SeYFrieD<br />
besucherInnen:<br />
6.059<br />
eine Ausstellung des <strong>Museum</strong>s für<br />
Völkerkunde in Kooperation mit dem<br />
Zentrum Moderner orient und den<br />
Basler Afrika Bibliographien