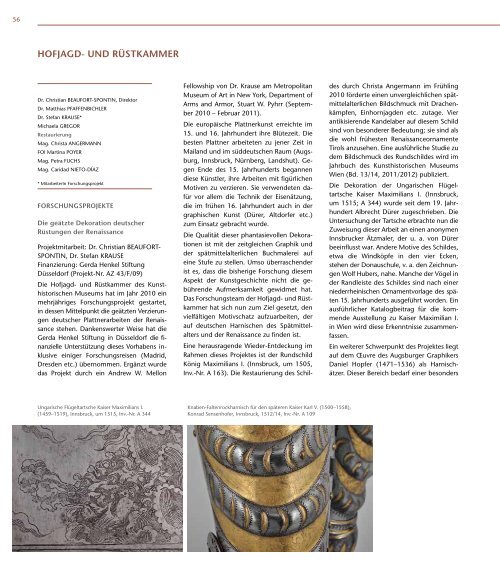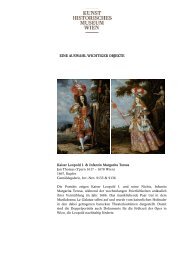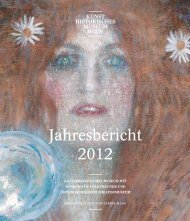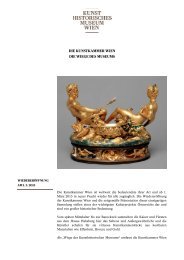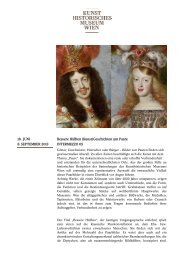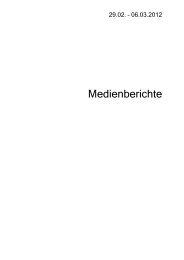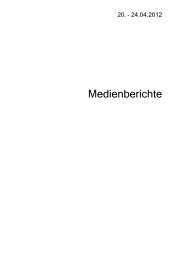Jahresbericht 2011 - Presse - Kunsthistorisches Museum Wien
Jahresbericht 2011 - Presse - Kunsthistorisches Museum Wien
Jahresbericht 2011 - Presse - Kunsthistorisches Museum Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
56<br />
hoFJagd- und rÜstkammer<br />
Dr. christian BeAUForT-SPonTin, Direktor<br />
Dr. Matthias PFAFFenBicHLer<br />
Dr. Stefan KrAUSe*<br />
Michaela GreGor<br />
restaurierung<br />
Mag. christa AnGerMAnn<br />
Foi Martina PoYer<br />
Mag. Petra FUcHS<br />
Mag. caridad nieTo-DÍAZ<br />
* Mitarbeiterin Forschungsprojekt<br />
ForschungsproJekte<br />
die geätzte dekoration deutscher<br />
rüstungen der renaissance<br />
Projektmitarbeit: Dr. christian BeAUForT-<br />
SPonTin, Dr. Stefan KrAUSe<br />
Finanzierung: Gerda Henkel Stiftung<br />
Düsseldorf (Projekt-nr. AZ 43/F/09)<br />
Die Hofjagd- und rüstkammer des Kunsthistorischen<br />
<strong>Museum</strong>s hat im Jahr 2010 ein<br />
mehrjähriges Forschungsprojekt gestartet,<br />
in dessen Mittelpunkt die geätzten Verzierungen<br />
deutscher Plattnerarbeiten der renaissance<br />
stehen. Dankenswerter Weise hat die<br />
Gerda Henkel Stiftung in Düsseldorf die finanzielle<br />
Unterstützung dieses Vor habens inklusive<br />
einiger Forschungsreisen (Madrid,<br />
Dresden etc.) übernommen. ergänzt wurde<br />
das Projekt durch ein Andrew W. Mellon<br />
Ungarische Flügeltartsche Kaiser Maximilians i.<br />
(1459–1519), innsbruck, um 1515, inv.-nr. A 344<br />
Fellowship von Dr. Krause am Metropolitan<br />
<strong>Museum</strong> of Art in new York, Department of<br />
Arms and Armor, Stuart W. Pyhrr (September<br />
2010 – Februar <strong>2011</strong>).<br />
Die europäische Plattnerkunst erreichte im<br />
15. und 16. Jahrhundert ihre Blütezeit. Die<br />
besten Plattner arbeiteten zu jener Zeit in<br />
Mailand und im süddeutschen raum (Augsburg,<br />
innsbruck, nürnberg, Landshut). Gegen<br />
ende des 15. Jahrhunderts begannen<br />
diese Künstler, ihre Arbeiten mit figürlichen<br />
Motiven zu verzieren. Sie verwendeten dafür<br />
vor allem die Technik der eisenätzung,<br />
die im frühen 16. Jahrhundert auch in der<br />
graphischen Kunst (Dürer, Altdorfer etc.)<br />
zum einsatz gebracht wurde.<br />
Die Qualität dieser phantasievollen Dekorationen<br />
ist mit der zeitgleichen Graphik und<br />
der spätmittelalterlichen Buchmalerei auf<br />
eine Stufe zu stellen. Umso überraschender<br />
ist es, dass die bisherige Forschung diesem<br />
Aspekt der Kunstgeschichte nicht die gebührende<br />
Aufmerksamkeit gewidmet hat.<br />
Das Forschungsteam der Hofjagd- und rüstkammer<br />
hat sich nun zum Ziel gesetzt, den<br />
vielfältigen Motivschatz aufzuarbeiten, der<br />
auf deutschen Harnischen des Spätmittelalters<br />
und der renaissance zu finden ist.<br />
eine herausragende Wieder-entdeckung im<br />
rahmen dieses Projektes ist der rundschild<br />
König Maximilians i. (innsbruck, um 1505,<br />
inv.-nr. A 163). Die restaurierung des Schil-<br />
Knaben-Faltenrockharnisch für den späteren Kaiser Karl V. (1500–1558),<br />
Konrad Sensenhofer, innsbruck, 1512/14, inv.-nr. A 109<br />
des durch christa Angermann im Frühling<br />
2010 förderte einen unvergleichlichen spätmittelalterlichen<br />
Bildschmuck mit Drachenkämpfen,<br />
einhornjagden etc. zutage. Vier<br />
antikisierende Kandelaber auf diesem Schild<br />
sind von be sonderer Bedeutung; sie sind als<br />
die wohl frühesten renaissanceornamente<br />
Tirols anzusehen. eine ausführliche Studie zu<br />
dem Bildschmuck des rundschildes wird im<br />
Jahrbuch des Kunsthistorischen <strong>Museum</strong>s<br />
<strong>Wien</strong> (Bd. 13/14, <strong>2011</strong>/2012) publiziert.<br />
Die Dekoration der Ungarischen Flügeltartsche<br />
Kaiser Maximilians i. (innsbruck,<br />
um 1515; A 344) wurde seit dem 19. Jahrhundert<br />
Albrecht Dürer zugeschrieben. Die<br />
Untersuchung der Tartsche erbrachte nun die<br />
Zuweisung dieser Arbeit an einen anonymen<br />
innsbrucker Ätzmaler, der u. a. von Dürer<br />
beeinflusst war. Andere Motive des Schildes,<br />
etwa die Windköpfe in den vier ecken,<br />
stehen der Donauschule, v. a. den Zeichnungen<br />
Wolf Hubers, nahe. Manche der Vögel in<br />
der randleiste des Schildes sind nach einer<br />
niederrheinischen ornamentvorlage des späten<br />
15. Jahrhunderts ausgeführt worden. ein<br />
ausführlicher Katalogbeitrag für die kommende<br />
Ausstellung zu Kaiser Maximilian i.<br />
in <strong>Wien</strong> wird diese erkenntnisse zusammenfassen.<br />
ein weiterer Schwerpunkt des Projektes liegt<br />
auf dem Œuvre des Augsburger Graphikers<br />
Daniel Hopfer (1471–1536) als Harnischätzer.<br />
Dieser Bereich bedarf einer besonders