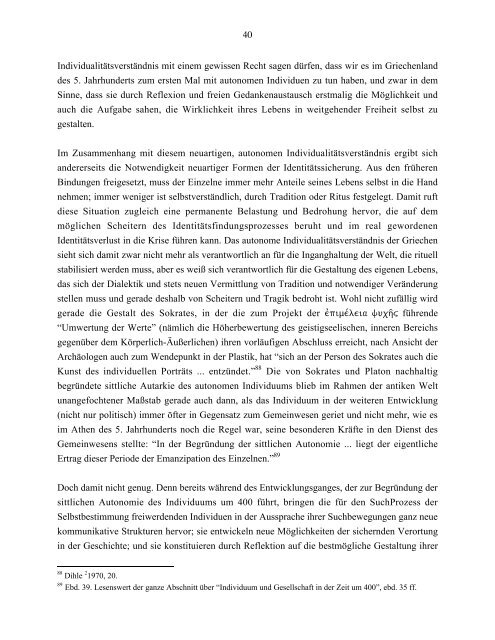2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
40<br />
Individualitätsverständnis mit einem gewissen Recht sagen dürfen, dass wir es im Griechenland<br />
des 5. Jahrh<strong>und</strong>erts zum ersten Mal mit autonomen Individuen zu tun haben, <strong>und</strong> zwar in dem<br />
Sinne, dass sie durch Reflexion <strong>und</strong> freien Gedankenaustausch erstmalig die Möglichkeit <strong>und</strong><br />
auch die Aufgabe sahen, die Wirklichkeit ihres Lebens in weitgehender Freiheit selbst zu<br />
gestalten.<br />
Im Zusammenhang mit diesem neuartigen, autonomen Individualitätsverständnis ergibt sich<br />
andererseits die Notwendigkeit neuartiger Formen der Identitätssicherung. Aus den früheren<br />
Bindungen freigesetzt, muss der Einzelne immer mehr Anteile seines Lebens selbst in die Hand<br />
nehmen; immer weniger ist selbstverständlich, durch Tradition oder Ritus festgelegt. Damit ruft<br />
diese Situation zugleich eine permanente Belastung <strong>und</strong> Bedrohung hervor, die auf dem<br />
möglichen Scheitern des Identitätsfindungsprozesses beruht <strong>und</strong> im real gewordenen<br />
Identitätsverlust in die Krise führen kann. Das autonome Individualitätsverständnis der Griechen<br />
sieht sich damit zwar nicht mehr als verantwortlich an für die Inganghaltung der Welt, die rituell<br />
stabilisiert werden muss, aber es weiß sich verantwortlich für die Gestaltung des eigenen Lebens,<br />
das sich der Dialektik <strong>und</strong> stets neuen Vermittlung von Tradition <strong>und</strong> notwendiger Veränderung<br />
stellen muss <strong>und</strong> gerade deshalb von Scheitern <strong>und</strong> Tragik bedroht ist. Wohl nicht zufällig wird<br />
gerade die Gestalt des Sokrates, in der die zum Projekt der eäpime´leia yuxh+Ó führende<br />
“Umwertung der Werte” (nämlich die Höherbewertung des geistigseelischen, inneren Bereichs<br />
gegenüber dem Körperlich-Äußerlichen) ihren vorläufigen Abschluss erreicht, nach Ansicht der<br />
Archäologen auch zum Wendepunkt in der Plastik, hat “sich an der Person des Sokrates auch die<br />
Kunst des individuellen Porträts ... entzündet.” 88 Die von Sokrates <strong>und</strong> Platon nachhaltig<br />
begründete sittliche Autarkie des autonomen Individuums blieb im Rahmen der antiken Welt<br />
unangefochtener Maßstab gerade auch dann, als das Individuum in der weiteren Entwicklung<br />
(nicht nur politisch) immer öfter in Gegensatz zum Gemeinwesen geriet <strong>und</strong> nicht mehr, wie es<br />
im Athen des 5. Jahrh<strong>und</strong>erts noch die Regel war, seine besonderen Kräfte in den Dienst des<br />
Gemeinwesens stellte: “In der Begründung der sittlichen Autonomie ... liegt der eigentliche<br />
Ertrag dieser Periode der Emanzipation des Einzelnen.” 89<br />
Doch damit nicht genug. Denn bereits während des Entwicklungsganges, der zur Begründung der<br />
sittlichen Autonomie des Individuums um 400 führt, bringen die für den SuchProzess der<br />
Selbstbestimmung freiwerdenden Individuen in der Aussprache ihrer Suchbewegungen ganz neue<br />
kommunikative Strukturen hervor; sie entwickeln neue Möglichkeiten der sichernden Verortung<br />
in der Geschichte; <strong>und</strong> sie konstituieren durch Reflektion auf die bestmögliche Gestaltung ihrer<br />
88 Dihle 2 1970, 20.<br />
89<br />
Ebd. 39. Lesenswert der ganze Abschnitt über “Individuum <strong>und</strong> Gesellschaft in der Zeit um 400”, ebd. 35 ff.