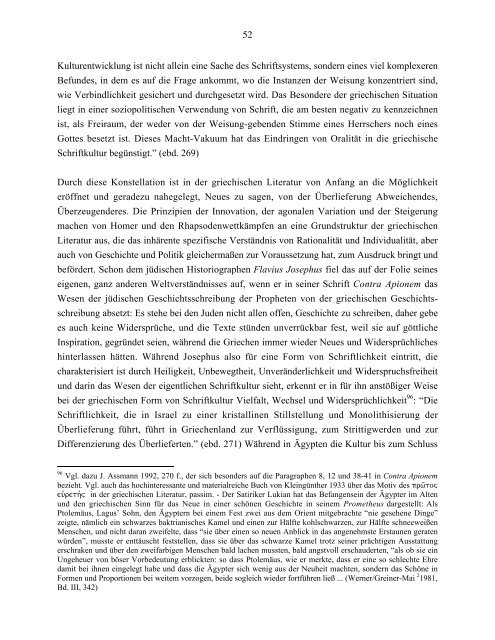2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
52<br />
Kulturentwicklung ist nicht allein eine Sache des Schriftsystems, sondern eines viel komplexeren<br />
Bef<strong>und</strong>es, in dem es auf die Frage ankommt, wo die Instanzen der Weisung konzentriert sind,<br />
wie Verbindlichkeit gesichert <strong>und</strong> durchgesetzt wird. Das Besondere der griechischen Situation<br />
liegt in einer soziopolitischen Verwendung von Schrift, die am besten negativ zu kennzeichnen<br />
ist, als Freiraum, der weder von der Weisung-gebenden Stimme eines Herrschers noch eines<br />
Gottes besetzt ist. Dieses Macht-Vakuum hat das Eindringen von Oralität in die griechische<br />
Schriftkultur begünstigt.” (ebd. 269)<br />
Durch diese Konstellation ist in der griechischen Literatur von Anfang an die Möglichkeit<br />
eröffnet <strong>und</strong> geradezu nahegelegt, Neues zu sagen, von der Überlieferung Abweichendes,<br />
Überzeugenderes. Die Prinzipien der Innovation, der agonalen Variation <strong>und</strong> der Steigerung<br />
machen von Homer <strong>und</strong> den Rhapsodenwettkämpfen an eine Gr<strong>und</strong>struktur der griechischen<br />
Literatur aus, die das inhärente spezifische Verständnis von Rationalität <strong>und</strong> Individualität, aber<br />
auch von Geschichte <strong>und</strong> Politik gleichermaßen zur Voraussetzung hat, zum Ausdruck bringt <strong>und</strong><br />
befördert. Schon dem jüdischen Historiographen Flavius Josephus fiel das auf der Folie seines<br />
eigenen, ganz anderen Weltverständnisses auf, wenn er in seiner Schrift Contra Apionem das<br />
Wesen der jüdischen Geschichtsschreibung der Propheten von der griechischen Geschichtsschreibung<br />
absetzt: Es stehe bei den Juden nicht allen offen, Geschichte zu schreiben, daher gebe<br />
es auch keine Widersprüche, <strong>und</strong> die Texte stünden unverrückbar fest, weil sie auf göttliche<br />
Inspiration, gegründet seien, während die Griechen immer wieder Neues <strong>und</strong> Widersprüchliches<br />
hinterlassen hätten. Während Josephus also für eine Form von Schriftlichkeit eintritt, die<br />
charakterisiert ist durch Heiligkeit, Unbewegtheit, Unveränderlichkeit <strong>und</strong> Widerspruchsfreiheit<br />
<strong>und</strong> darin das Wesen der eigentlichen Schriftkultur sieht, erkennt er in für ihn anstößiger Weise<br />
bei der griechischen Form von Schriftkultur Vielfalt, Wechsel <strong>und</strong> Widersprüchlichkeit 96 : “Die<br />
Schriftlichkeit, die in Israel zu einer kristallinen Stillstellung <strong>und</strong> Monolithisierung der<br />
Überlieferung führt, führt in Griechenland zur Verflüssigung, zum Strittigwerden <strong>und</strong> zur<br />
Differenzierung des Überlieferten.” (ebd. 271) Während in Ägypten die Kultur bis zum Schluss<br />
96<br />
Vgl. dazu J. Assmann 1992, 270 f., der sich besonders auf die Paragraphen 8, 12 <strong>und</strong> 38-41 in Contra Apionem<br />
bezieht. Vgl. auch das hochinteressante <strong>und</strong> materialreiche Buch von Kleingünther 1933 über das Motiv des prw+toÓ<br />
euÄreth´Ó in der griechischen Literatur, passim. - Der Satiriker Lukian hat das Befangensein der Ägypter im Alten<br />
<strong>und</strong> den griechischen Sinn für das Neue in einer schönen Geschichte in seinem Prometheus dargestellt: Als<br />
Ptolemäus, Lagus’ Sohn, den Ägyptern bei einem Fest zwei aus dem Orient mitgebrachte “nie gesehene Dinge”<br />
zeigte, nämlich ein schwarzes baktrianisches Kamel <strong>und</strong> einen zur Hälfte kohlschwarzen, zur Hälfte schneeweißen<br />
Menschen, <strong>und</strong> nicht daran zweifelte, dass “sie über einen so neuen Anblick in das angenehmste Erstaunen geraten<br />
würden”, musste er enttäuscht feststellen, dass sie über das schwarze Kamel trotz seiner prächtigen Ausstattung<br />
erschraken <strong>und</strong> über den zweifarbigen Menschen bald lachen mussten, bald angstvoll erschauderten, “als ob sie ein<br />
Ungeheuer von böser Vorbedeutung erblickten: so dass Ptolemäus, wie er merkte, dass er eine so schlechte Ehre<br />
damit bei ihnen eingelegt habe <strong>und</strong> dass die Ägypter sich wenig aus der Neuheit machten, sondern das Schöne in<br />
Formen <strong>und</strong> Proportionen bei weitem vorzogen, beide sogleich wieder fortführen ließ ... (Werner/Greiner-Mai 2 1981,<br />
Bd. III, 342)