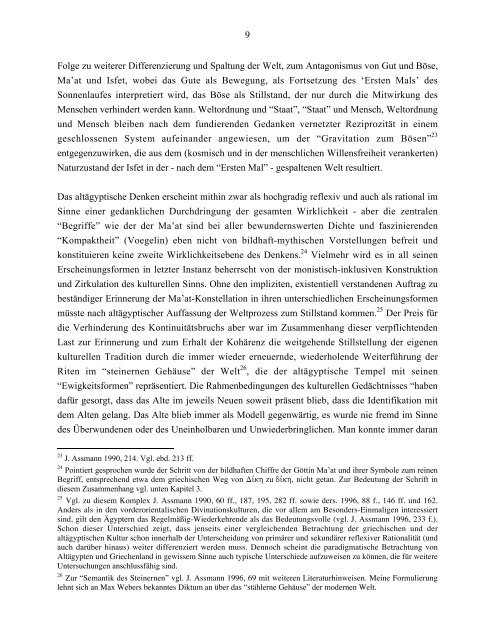2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
9<br />
Folge zu weiterer Differenzierung <strong>und</strong> Spaltung der Welt, zum Antagonismus von Gut <strong>und</strong> Böse,<br />
Ma’at <strong>und</strong> Isfet, wobei das Gute als Bewegung, als Fortsetzung des ‘Ersten Mals’ des<br />
Sonnenlaufes interpretiert wird, das Böse als Stillstand, der nur durch die Mitwirkung des<br />
Menschen verhindert werden kann. Weltordnung <strong>und</strong> “Staat”, “Staat” <strong>und</strong> Mensch, Weltordnung<br />
<strong>und</strong> Mensch bleiben nach dem f<strong>und</strong>ierenden Gedanken vernetzter Reziprozität in einem<br />
geschlossenen System aufeinander angewiesen, um der “Gravitation zum Bösen” 23<br />
entgegenzuwirken, die aus dem (kosmisch <strong>und</strong> in der menschlichen Willensfreiheit verankerten)<br />
Naturzustand der Isfet in der - nach dem “Ersten Mal” - gespaltenen Welt resultiert.<br />
Das altägyptische Denken erscheint mithin zwar als hochgradig reflexiv <strong>und</strong> auch als rational im<br />
Sinne einer gedanklichen Durchdringung der gesamten Wirklichkeit - aber die zentralen<br />
“Begriffe” wie der der Ma’at sind bei aller bew<strong>und</strong>ernswerten Dichte <strong>und</strong> faszinierenden<br />
“Kompaktheit” (Voegelin) eben nicht von bildhaft-mythischen Vorstellungen befreit <strong>und</strong><br />
konstituieren keine zweite Wirklichkeitsebene des Denkens. 24 Vielmehr wird es in all seinen<br />
Erscheinungsformen in letzter Instanz beherrscht von der monistisch-inklusiven Konstruktion<br />
<strong>und</strong> Zirkulation des kulturellen Sinns. Ohne den impliziten, existentiell verstandenen Auftrag zu<br />
beständiger Erinnerung der Ma’at-Konstellation in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen<br />
müsste nach altägyptischer Auffassung der Weltprozess zum Stillstand kommen. 25 Der Preis für<br />
die Verhinderung des Kontinuitätsbruchs aber war im Zusammenhang dieser verpflichtenden<br />
Last zur Erinnerung <strong>und</strong> zum Erhalt der Kohärenz die weitgehende Stillstellung der eigenen<br />
kulturellen Tradition durch die immer wieder erneuernde, wiederholende Weiterführung der<br />
Riten im “steinernen Gehäuse” der Welt 26 , die der altägyptische Tempel mit seinen<br />
“Ewigkeitsformen” repräsentiert. Die Rahmenbedingungen des kulturellen Gedächtnisses “haben<br />
dafür gesorgt, dass das Alte im jeweils Neuen soweit präsent blieb, dass die Identifikation mit<br />
dem Alten gelang. Das Alte blieb immer als Modell gegenwärtig, es wurde nie fremd im Sinne<br />
des Überw<strong>und</strong>enen oder des Uneinholbaren <strong>und</strong> Unwiederbringlichen. Man konnte immer daran<br />
23 J. Assmann 1990, 214. Vgl. ebd. 213 ff.<br />
24 Pointiert gesprochen wurde der Schritt von der bildhaften Chiffre der Göttin Ma’at <strong>und</strong> ihrer Symbole zum reinen<br />
Begriff, entsprechend etwa dem griechischen Weg von Di´kh zu di´kh, nicht getan. Zur Bedeutung der Schrift in<br />
diesem Zusammenhang vgl. unten Kapitel 3.<br />
25 Vgl. zu diesem Komplex J. Assmann 1990, 60 ff., 187, 195, 282 ff. sowie ders. 1996, 88 f., 146 ff. <strong>und</strong> 16<strong>2.</strong><br />
Anders als in den vorderorientalischen Divinationskulturen, die vor allem am Besonders-Einmaligen interessiert<br />
sind, gilt den Ägyptern das Regelmäßig-Wiederkehrende als das Bedeutungsvolle (vgl. J. Assmann 1996, 233 f.).<br />
Schon dieser Unterschied zeigt, dass jenseits einer vergleichenden Betrachtung der griechischen <strong>und</strong> der<br />
altägyptischen Kultur schon innerhalb der Unterscheidung von primärer <strong>und</strong> sek<strong>und</strong>ärer reflexiver Rationalität (<strong>und</strong><br />
auch darüber hinaus) weiter differenziert werden muss. Dennoch scheint die paradigmatische Betrachtung von<br />
Altägypten <strong>und</strong> Griechenland in gewissem Sinne auch typische Unterschiede aufzuweisen zu können, die für weitere<br />
Untersuchungen anschlussfähig sind.<br />
26 Zur “Semantik des Steinernen” vgl. J. Assmann 1996, 69 mit weiteren Literaturhinweisen. Meine Formulierung<br />
lehnt sich an Max Webers bekanntes Diktum an über das “stählerne Gehäuse” der modernen Welt.