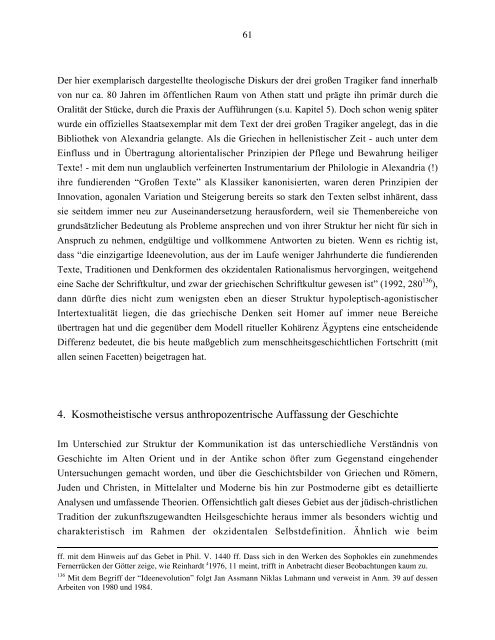2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
2. Ma'at und Logos. - Vergleichende - Dittmer, Jörg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
61<br />
Der hier exemplarisch dargestellte theologische Diskurs der drei großen Tragiker fand innerhalb<br />
von nur ca. 80 Jahren im öffentlichen Raum von Athen statt <strong>und</strong> prägte ihn primär durch die<br />
Oralität der Stücke, durch die Praxis der Aufführungen (s.u. Kapitel 5). Doch schon wenig später<br />
wurde ein offizielles Staatsexemplar mit dem Text der drei großen Tragiker angelegt, das in die<br />
Bibliothek von Alexandria gelangte. Als die Griechen in hellenistischer Zeit - auch unter dem<br />
Einfluss <strong>und</strong> in Übertragung altorientalischer Prinzipien der Pflege <strong>und</strong> Bewahrung heiliger<br />
Texte! - mit dem nun unglaublich verfeinerten Instrumentarium der Philologie in Alexandria (!)<br />
ihre f<strong>und</strong>ierenden “Großen Texte” als Klassiker kanonisierten, waren deren Prinzipien der<br />
Innovation, agonalen Variation <strong>und</strong> Steigerung bereits so stark den Texten selbst inhärent, dass<br />
sie seitdem immer neu zur Auseinandersetzung herausfordern, weil sie Themenbereiche von<br />
gr<strong>und</strong>sätzlicher Bedeutung als Probleme ansprechen <strong>und</strong> von ihrer Struktur her nicht für sich in<br />
Anspruch zu nehmen, endgültige <strong>und</strong> vollkommene Antworten zu bieten. Wenn es richtig ist,<br />
dass “die einzigartige Ideenevolution, aus der im Laufe weniger Jahrh<strong>und</strong>erte die f<strong>und</strong>ierenden<br />
Texte, Traditionen <strong>und</strong> Denkformen des okzidentalen Rationalismus hervorgingen, weitgehend<br />
eine Sache der Schriftkultur, <strong>und</strong> zwar der griechischen Schriftkultur gewesen ist” (1992, 280 136 ),<br />
dann dürfte dies nicht zum wenigsten eben an dieser Struktur hypoleptisch-agonistischer<br />
Intertextualität liegen, die das griechische Denken seit Homer auf immer neue Bereiche<br />
übertragen hat <strong>und</strong> die gegenüber dem Modell ritueller Kohärenz Ägyptens eine entscheidende<br />
Differenz bedeutet, die bis heute maßgeblich zum menschheitsgeschichtlichen Fortschritt (mit<br />
allen seinen Facetten) beigetragen hat.<br />
4. Kosmotheistische versus anthropozentrische Auffassung der Geschichte<br />
Im Unterschied zur Struktur der Kommunikation ist das unterschiedliche Verständnis von<br />
Geschichte im Alten Orient <strong>und</strong> in der Antike schon öfter zum Gegenstand eingehender<br />
Untersuchungen gemacht worden, <strong>und</strong> über die Geschichtsbilder von Griechen <strong>und</strong> Römern,<br />
Juden <strong>und</strong> Christen, in Mittelalter <strong>und</strong> Moderne bis hin zur Postmoderne gibt es detaillierte<br />
Analysen <strong>und</strong> umfassende Theorien. Offensichtlich galt dieses Gebiet aus der jüdisch-christlichen<br />
Tradition der zukunftszugewandten Heilsgeschichte heraus immer als besonders wichtig <strong>und</strong><br />
charakteristisch im Rahmen der okzidentalen Selbstdefinition. Ähnlich wie beim<br />
ff. mit dem Hinweis auf das Gebet in Phil. V. 1440 ff. Dass sich in den Werken des Sophokles ein zunehmendes<br />
Fernerrücken der Götter zeige, wie Reinhardt 4 1976, 11 meint, trifft in Anbetracht dieser Beobachtungen kaum zu.<br />
136 Mit dem Begriff der “Ideenevolution” folgt Jan Assmann Niklas Luhmann <strong>und</strong> verweist in Anm. 39 auf dessen<br />
Arbeiten von 1980 <strong>und</strong> 1984.