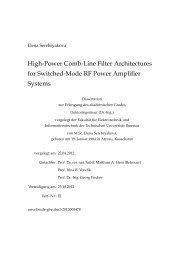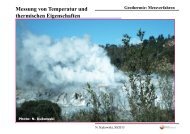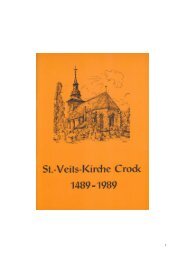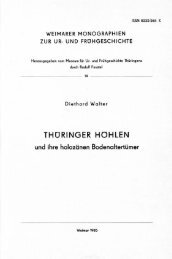Darstellung und Analyse hydrologischer Topologien auf der Basis ...
Darstellung und Analyse hydrologischer Topologien auf der Basis ...
Darstellung und Analyse hydrologischer Topologien auf der Basis ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
70 Anwendung: Das Talsperrensystem Weida-Zeulenroda<br />
Um das skizzierte Problemfeld zu bearbeiten <strong>und</strong> so Unterstützung bei <strong>der</strong> Ermittlung von Anb<strong>auf</strong>lächen<br />
zu leisten, <strong>auf</strong> denen Maßnahmen, die <strong>auf</strong> die Verringerung des N-Eintrags in das Talsperrensystem<br />
zielen, eine optimale Wirkung entfalten, sollte das im Kapitel 2 beschriebene Verfahren<br />
angewandt werden. Im Folgenden soll nach einer genaueren Charakterisierung des Einzugsgebietes<br />
des Talsperrensystems Weida-Zeulenroda-Lössau sowie einer Beschreibung des eingesetzten Stofftransportmodells<br />
die Anwendung des beschriebenen Optimierungverfahrens dokumentiert <strong>und</strong> die<br />
Ergebnisse präsentiert werden.<br />
3.1 Charakterisierung des Einzugsgebietes<br />
3.1.1 Geografische Einordnung<br />
Die nachfolgenden Angaben zur Charakterisierung des Einzugsgebietes wurden, wenn nicht an<strong>der</strong>s<br />
gekennzeichnet, <strong>der</strong> Dissertation von Fink (2004) entnommen.<br />
Das Untersuchungsgebiet, für das die im Kapitel 2 beschriebenen Verfahren angewandt werden sollen,<br />
ist ca. 30 km südlich von Gera, an <strong>der</strong> Grenze zwischen Thüringen <strong>und</strong> Sachsen gelegen <strong>und</strong> umfasst<br />
das Einzugsgebiet <strong>der</strong> Talsperren Zeulenroda <strong>und</strong> Weida (Abbildung 3.1). Die Gesamtfläche beträgt<br />
163 km 2 , wobei 139,65 km 2 <strong>auf</strong> das Einzugsgebiet <strong>der</strong> Talsperre Zeulenroda entfallen. Etwa 70 % <strong>der</strong><br />
Fäche des EZG sind den Thüringer Landkreisen Saale-Orla-Kreis <strong>und</strong> Greiz zugehörig, während die<br />
verbleibenden 30 % zum sächsischen Vogtlandkreis gehören.<br />
Der Naturraum des Untersuchungsgebietes lässt sich dem östlichen Teil des Thüringer Schiefergebirges<br />
zuordnen. Er wird morphologisch durch den Schiefergebirgsrumpf mit einem ausgeprägten<br />
Hochflächencharakter <strong>und</strong> einzelnen Härtlingsrücken bestimmt. Die dominierende Talform ist das<br />
Kerb- bzw. Kerbsohlental. Im südlichen Teil des Einzugsgebietes sind die Täler breiter <strong>und</strong> eher als<br />
Muldentäler ausgebildet (Schultze 1955). Die Höhe des Untersuchungsgebietes schwankt zwischen<br />
315 m über dem Meeresspiegel am Fuße <strong>der</strong> Talsperre Weida <strong>und</strong> 565 m über dem Meeresspiegel im<br />
südlichen Teil.<br />
3.1.2 Lithologische <strong>und</strong> pedologische Verhältnisse<br />
Die Gesteinsstruktur im Untersuchungsgebiet ist entsprechend <strong>der</strong> Lage sehr differenziert. Vorherrschende<br />
Gesteine <strong>auf</strong> den genannten Hochflächen sind Ton- <strong>und</strong> Kieselschiefer kambrischen o<strong>der</strong><br />
silurischen Ursprungs. An den Flanken sind dagegen devonische Schiefer, Grauwacken, Breccien <strong>und</strong><br />
Quarzite zu finden. Die Täler des Talsperreneinzugsgebietes sind mit holozänen Auesedimenten wie<br />
Schotter o<strong>der</strong> Auelehm verfüllt. Abbildung 3.2 zeigt die Tektonik <strong>und</strong> Landschaftsform im östlichen<br />
Thüringer Schiefergebirge.