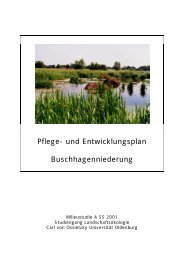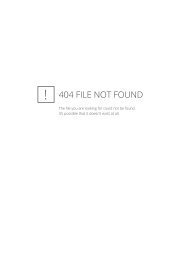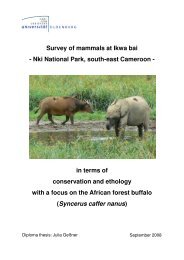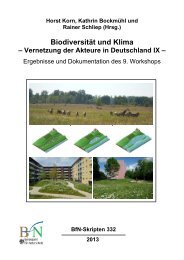DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4 Methoden 12<br />
4.1 Datengrundlage für das Atlasmodell<br />
Die Modellierung auf dieser Skala beruht größtenteils auf Datenbanken verschiedener<br />
Schweizer Behörden. Diese stellte mir die Schweizerische Vogelwarte Sempach innerhalb<br />
einer Zusammenarbeit mit Dr. Boris Schröder (jetzt Universität Potsdam) und Dr. Aletta<br />
Bonn (University of Sheffield) zur Verfügung. Die Aufbereitung der Daten für die<br />
Modellierung habe ich teilweise aus den Vorarbeiten zum Projekt „Modellierung zum<br />
neuen Schweizer Brutvogelatlas“ übernommen.<br />
Allen Daten liegen in rasterbasierter Form vor. Als Grundeinheit gelten die Quadrate,<br />
welche auf den Landeskarten der Schweiz durch die Kilometer-Koordinatenlinien definiert<br />
sind und deren Rastergröße 1 km 2 beträgt. Rasterzellen, die z.T. im Ausland liegen, wurden<br />
bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Die Daten aus den biogeographischen Einheiten<br />
Mittelland und Jura wurden bei der Modellbildung ebenfalls nicht zur Berechnung<br />
herangezogen. Es gab dort offenbar nie Steinhuhnvorkommen, und geeignete Habitate<br />
sind nur lokal auf kleinsten Flächen im Jura vorhanden (ZBINDEN, mündl. Mitt.). Eine<br />
Anwendung des errechneten Modells findet aber für die ganze Schweiz statt.<br />
4.1.1 Daten zum Steinhuhnvorkommen<br />
Die Daten zum Vorkommen- und Nichtvorkommen des Steinhuhns stammen aus den<br />
Kartierungen zum Schweizer Brutvogelatlas. Gegenüber dem ersten Atlas von 1980 wurde<br />
eine halbquantitative Erfassung durchgeführt, die außer zur Verbreitung, auch Aussagen<br />
zur Häufigkeit der Arten zulässt (SCHMID et al. 1998). Die Kartierung erfolgte in den<br />
Jahren 1993-1996 in 2734 Kilometerquadraten des Schweizer Koordinatensystems. Dies<br />
entspricht einem Anteil an der Landesfläche von 6,6% und garantiert auf regionaler Ebene<br />
eine ausreichende Genauigkeit. Eine wesentliche Verbesserung wäre erst bei einer<br />
Kartierung von etwa 25% der Fläche zu erwarten, was den Rahmen des Vorhabens<br />
gesprengt hätte. Spezielles Gewicht kommt aber in jedem Fall der repräsentativen Auswahl<br />
der Flächen, bzw. der Verteilung in den Lebensräumen zu.<br />
Aufgrund der teilweise sehr schwierigen topographischen Verhältnisse, wäre eine zufällige<br />
Auswahl der Probeflächen nicht sinnvoll gewesen. Daher wurden in jedem der 467<br />
Atlasquadrate (10 x 10 km-Raster) die zu bearbeitenden Kilometerquadrate von der<br />
Vogelwarte optisch aufgrund der Landeskarten 1: 100 000 ausgewählt. Die Absicht einer<br />
repräsentativen Auswahl wurde dabei durch den Abgleich mit den Daten zur Arealstatistik<br />
(s.u.) des Bundesamtes für Statistik gewährleistet. Jeweils fünf Kilometerquadrate<br />
(fünf obligatorisch und fünf fakultativ) wurden so gewählt, dass die Höhenlage, die Fläche<br />
des Waldes und der übrigen wichtigen Habitate sowie die Exposition etwa dieselben<br />
Anteile erreichten wie im ganzen Atlasquadrat. Auch die räumliche Verteilung innerhalb<br />
des Atlasquadrates wurde berücksichtigt. Ausgenommen von der Kartierung waren unter<br />
anderem Gletscher und Hochgebirgsregionen über 2500 m. Atlasquadrate mit nur<br />
geringem Anteil von Flächen unter 2500 m wurden aber wenn möglich mit mindestes drei<br />
obligatorischen Kilometerquadraten beprobt, da die hochgelegenen Flächen sonst nicht