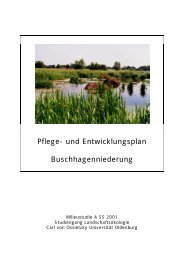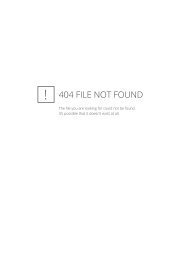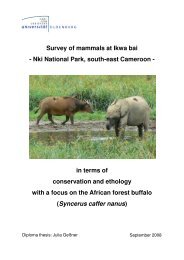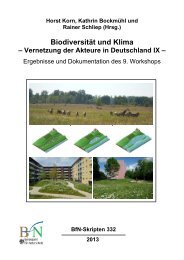DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 Diskussion 74<br />
Entwicklung stehen verschiedene Überlegungen gegenüber, welche sich positiv oder<br />
negativ auf den Bestand des Steinhuhns auswirken könnten.<br />
Bereits erwähnt wurde der starke menschliche Einfluss, welcher auch in Zukunft zu<br />
waldfreien Gebieten auf potentiellen Waldstandorten führen wird. Es gibt zwar<br />
Bestrebungen, statt einer hauptsächlich schutzorientierten Planung mehr Gewicht auf das<br />
Entwicklungspotential von Landschaften zu legen (http://www.umweltschweiz.ch/buwal/<br />
de/fachgebiete/fg_landnutzung/kulturland/strategie), aber im Schweizer Bundesgesetz<br />
über den Natur- und Heimatschutz (NHG) sind Schutz, Erhalt und Pflege von<br />
„heimatlichen Landschaften und Kulturdenkmälern“ gesetzlich festgeschrieben (Art. 1).<br />
Wenn ein Grundeigentümer im Interesse der Schutzziele eine Leistung ohne<br />
entsprechenden wirtschaftlichen Ertrag erbringt (was im Fall der aufwändigen<br />
Bewirtschaftung in den Bergen oft der Fall ist), hat er einen Anspruch auf finanziellen<br />
Ausgleich (Art. 18c). Gerade in den Berggebieten wird durch agrarpolitische<br />
Direktzahlungen ein Anreiz geschaffen, die Bewirtschaftung beizubehalten. Das<br />
„Landschaftskonzept Schweiz“ (LKS) nimmt in seiner, für alle in der Landschaft tätigen<br />
Bundesstellen verbindlichen, langfristigen Zielsetzung eine vermittelnde Haltung ein.<br />
Kulturlandschaften sollen in ihrer Eigenart, Vielfalt und Schönheit schonend entwickelt<br />
werden, wobei ihre Geschichte und Bedeutung ablesbar bleiben muss<br />
(http://www.landschaftskonzept.ch). So übernehmen die Bergbauern zunehmend auch<br />
landschaftspflegerische Aufgaben, was in einem neuen Landwirtschaftsartikel in der<br />
Bundesverfassung auch ausdrücklich anerkannt wird.<br />
Die Reaktionszeit der Bäume auf veränderte Verhältnisse spielt eine entscheidende Rolle.<br />
Bäume als physiologische Einheiten verhalten sich oft asynchron zu ihrer Umwelt.<br />
Faktoren wie Samenverbreitungsmechanismen, Keimraten, Konstanz der Klimaerwärmung<br />
und die Geschwindigkeit der Bodenentwicklung sind wichtige Einflussgrößen (BOLLIGER<br />
2002). In trockenen, inneralpinen Tälern ist außerdem auch eine Versteppung möglich, falls<br />
sich keine mediterranen Baumarten ansiedeln. Ob die alpine Stufe in naher Zukunft<br />
bewaldet wird, bleibt letztlich kontrovers (BOLLIGER 2002). Eine Erhöhung der<br />
Waldgrenze ist nicht zwingende Folge eines Temperaturanstiegs und wird in einer<br />
Simulation von BOLLIGER et al. (2000) auch nicht vorhergesagt. Andererseits zeigen erste<br />
(statistisch ungesicherte) Ergebnisse einer Studie des Institutes für Wald, Schnee und<br />
Landschaft (WSL), dass die Waldgrenze in den Jahren 1985 bis 1997 tatsächlich<br />
angestiegen ist (JAQUELINE GEHRIG-FASEL, schriftl. Mitt.).<br />
Zu welchem Nutzungstyp sich der auf den Brachflächen stockende Wald entwickeln wird,<br />
ist ein Untersuchungsschwerpunkt des Projektes WaSAlp (Waldausdehnung im Schweizer<br />
Alpenraum) des WSL. Die univariate Analyse dynamischer Landschaftsmodelle zeigt in<br />
ersten Ergebnissen (http://www.wsl.ch/projects/ WaSAlp), dass sich im Bereich der<br />
heutigen Waldgrenze (1800 bis 2200 m) „Gebüschwald“ (wie in der vorliegenden Arbeit<br />
per Definition des BFS (2001)) selten zu „Aufgelöstem Wald“ und fast nie zu<br />
„Geschlossenem Wald“ entwickelt, sondern „Gebüschwald“ bleibt. Der Nutzungstyp