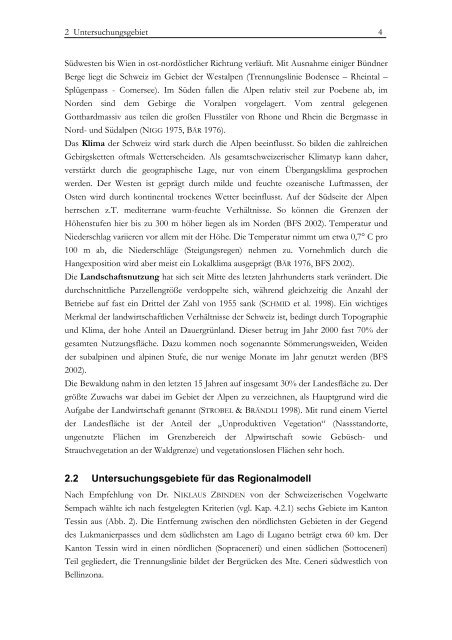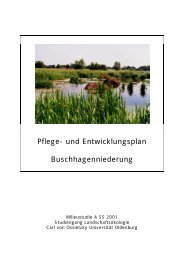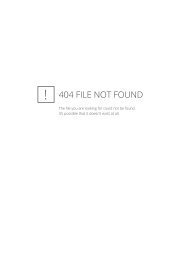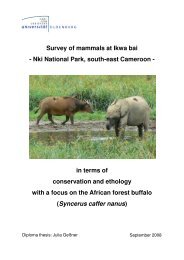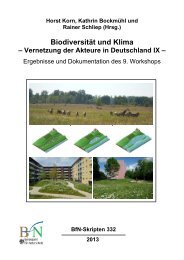DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 Untersuchungsgebiet 4<br />
Südwesten bis Wien in ost-nordöstlicher Richtung verläuft. Mit Ausnahme einiger Bündner<br />
Berge liegt die Schweiz im Gebiet der Westalpen (Trennungslinie Bodensee – Rheintal –<br />
Splügenpass - Comersee). Im Süden fallen die Alpen relativ steil zur Poebene ab, im<br />
Norden sind dem Gebirge die Voralpen vorgelagert. Vom zentral gelegenen<br />
Gotthardmassiv aus teilen die großen Flusstäler von Rhone und Rhein die Bergmasse in<br />
Nord- und Südalpen (NIGG 1975, BÄR 1976).<br />
Das Klima der Schweiz wird stark durch die Alpen beeinflusst. So bilden die zahlreichen<br />
Gebirgsketten oftmals Wetterscheiden. Als gesamtschweizerischer Klimatyp kann daher,<br />
verstärkt durch die geographische Lage, nur von einem Übergangsklima gesprochen<br />
werden. Der Westen ist geprägt durch milde und feuchte ozeanische Luftmassen, der<br />
Osten wird durch kontinental trockenes Wetter beeinflusst. Auf der Südseite der Alpen<br />
herrschen z.T. mediterrane warm-feuchte Verhältnisse. So können die Grenzen der<br />
Höhenstufen hier bis zu 300 m höher liegen als im Norden (BFS 2002). Temperatur und<br />
Niederschlag variieren vor allem mit der Höhe. Die Temperatur nimmt um etwa 0,7° C pro<br />
100 m ab, die Niederschläge (Steigungsregen) nehmen zu. Vornehmlich durch die<br />
Hangexposition wird aber meist ein Lokalklima ausgeprägt (BÄR 1976, BFS 2002).<br />
Die Landschaftsnutzung hat sich seit Mitte des letzten Jahrhunderts stark verändert. Die<br />
durchschnittliche Parzellengröße verdoppelte sich, während gleichzeitig die Anzahl der<br />
Betriebe auf fast ein Drittel der Zahl von 1955 sank (SCHMID et al. 1998). Ein wichtiges<br />
Merkmal der landwirtschaftlichen Verhältnisse der Schweiz ist, bedingt durch Topographie<br />
und Klima, der hohe Anteil an Dauergrünland. Dieser betrug im Jahr 2000 fast 70% der<br />
gesamten Nutzungsfläche. Dazu kommen noch sogenannte Sömmerungsweiden, Weiden<br />
der subalpinen und alpinen Stufe, die nur wenige Monate im Jahr genutzt werden (BFS<br />
2002).<br />
Die Bewaldung nahm in den letzten 15 Jahren auf insgesamt 30% der Landesfläche zu. Der<br />
größte Zuwachs war dabei im Gebiet der Alpen zu verzeichnen, als Hauptgrund wird die<br />
Aufgabe der Landwirtschaft genannt (STROBEL & BRÄNDLI 1998). Mit rund einem Viertel<br />
der Landesfläche ist der Anteil der „Unproduktiven Vegetation“ (Nassstandorte,<br />
ungenutzte Flächen im Grenzbereich der Alpwirtschaft sowie Gebüsch- und<br />
Strauchvegetation an der Waldgrenze) und vegetationslosen Flächen sehr hoch.<br />
2.2 Untersuchungsgebiete für das Regionalmodell<br />
Nach Empfehlung von Dr. NIKLAUS ZBINDEN von der Schweizerischen Vogelwarte<br />
Sempach wählte ich nach festgelegten Kriterien (vgl. Kap. 4.2.1) sechs Gebiete im Kanton<br />
Tessin aus (Abb. 2). Die Entfernung zwischen den nördlichsten Gebieten in der Gegend<br />
des Lukmanierpasses und dem südlichsten am Lago di Lugano beträgt etwa 60 km. Der<br />
Kanton Tessin wird in einen nördlichen (Sopraceneri) und einen südlichen (Sottoceneri)<br />
Teil gegliedert, die Trennungslinie bildet der Bergrücken des Mte. Ceneri südwestlich von<br />
Bellinzona.