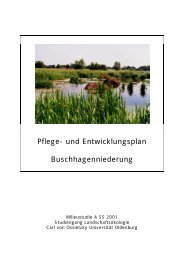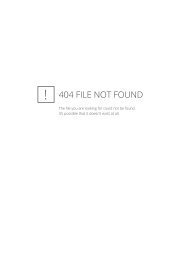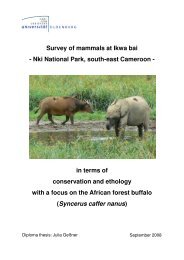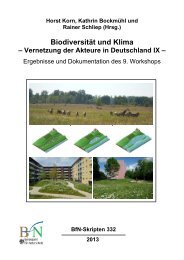DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6 Diskussion 81<br />
6.3.2 Maßnahmen<br />
Konkrete Maßnahmen sollten sich an der Biologie der Art orientieren, die Reproduktivität<br />
der Art nachhaltig steigern, ökonomisch vertretbar sein, mit dem lokalen<br />
sozioökonomischen Umfeld vereinbar sein und im Rahmen von Mitnahmeeffekten<br />
anderen Arten zugute kommen (SNYDER 2000).<br />
Nach ODASSO<br />
& FRANCESCHI (1998) können die Maßnahmen auf folgende<br />
Teilhabitate/Höhenstufen aufgeteilt werden (ob der Begriff des Primärhabitats hier<br />
gerechtfertigt ist, kann aufgrund von Herkunft und aktueller Verbreitung der Art als<br />
diskussionswürdig angesehen werden):<br />
a) Primärhabitat: (Krummseggenrasen, Blaugrashalden, alpine Stufe) ist stabil und<br />
bedarf keiner Maßnahmen.<br />
b) Sekundäres Trockenhabitat (Trockenrasen) braucht nur gezielte, gelegentliche<br />
Einsätze.<br />
c) Alle anderen Sekundärhabitate sind weniger stabil und brauchen konstante und<br />
extensive Nutzung, am besten durch Schaf-Umtriebweide, um die Buschanzahl<br />
unter der von der Art akzeptierten Obergrenze zu halten.<br />
DE FRANCESCHI (1994) stellt für den Schutz in den Italienischen Alpen ein Konzept auf,<br />
welches hier teilweise verändert wiedergegeben wird. Zunächst sollen durch weitere<br />
Beobachtungen zu allen Jahreszeiten weitere Kenntnisse zum Verhalten der Art (vor allem<br />
zu Ausbreitungstendenzen und Bewegungsradius) gewonnen werden. So kann die Größe<br />
der Fläche für entsprechende Maßnahmen ermittelt werden, oder von Teilflächen, welche<br />
durch Habitatvernetzung miteinander verbunden sind. Von primärem Interesse für den<br />
Schutz der Art sind die im Winter genutzten Lebensräume. Denn soweit die Tiere nicht an<br />
Windkanten höherer Lagen überwintern, sind sie zu dieser Jahreszeit auf vom Menschen<br />
genutzte Flächen angewiesen. Vertikale Verbindungen zwischen den Teillebensräumen sind<br />
dann ebenfalls wichtige Schutzobjekte. In allen Fällen ist eine Kontrolle der Maßnahmen<br />
durchzuführen. Folgende Maßnahmen zum Schutz der Art bieten sich an:<br />
1. Erhaltung eines Mosaiks aus niedriger, krautiger Vegetation, Gebüsch und Felsen<br />
in geeigneten Brutgebieten. Keines der Strukturelemente sollte Flächenanteile über<br />
50% aufweisen. Dabei kann auf den periodischen Einsatz von Maschinen zur<br />
Beseitigung aufkommender Verbuschung im Spätsommer nicht verzichtet werden.<br />
2. Einführen halbwilder Ziegen- oder Pferdeherden, dies bedeutet weniger<br />
Pflegeaufwand und verhindert eine weitere Verbuschung (Abb. 21).<br />
3. Einsatz von Ziegen auch nach Verjüngung der Krautvegetation durch<br />
schachbrettartige Bodenreinigung in von Gehölzen überwucherten Bereichen,<br />
welche als Winterlebensraum dienen.<br />
4. Erst kürzlich verlassene Bergweiden mähen und das Mähgut abtragen<br />
(Nährstoffentzug). Diese Bereiche eignen sich auch als Wintereinstand für wilde<br />
Huftiere, welche durch Verbiss die Flächen weiter offen halten.