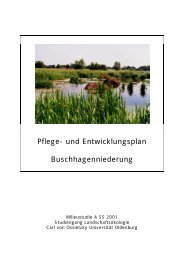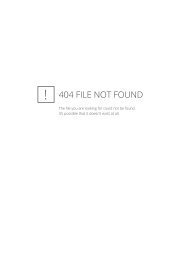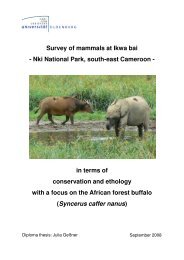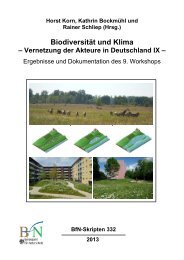DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6 Diskussion 80<br />
und stochastische Modelle (Klimaeinflüsse) an. Als mögliche Fehlerquellen nennen sie u.a.<br />
die Nichtberücksichtigung der Varianz der Überlebensraten, von Jagddruck, Anwesenheit<br />
von Schutzmöglichkeiten vor dem Schnee bzw. Ausweichverhalten der Art auf<br />
windexponierte Kuppen, sowie die fehlende Berücksichtigung des Kontaktes mit einer<br />
größeren Metapopulation. Folgende Szenarien wurden erstellt:<br />
a) katastrophale Klimaereignisse (50% Bestandsverlust) mit festgelegter Häufigkeit<br />
(empirisch auf alle 10 Jahre festgelegt) bei 25 Jahren Laufzeit des Modells<br />
b) gute, mittlere und schlechte Brutjahre im Verhältnis zueinander<br />
c) Kombination aus a) und b)<br />
Ergebnis ihrer Untersuchung ist, dass eine Population, die nicht durch katastrophale<br />
Wettereinflüsse beeinträchtigt wird (hypothetisch), eine positive Wachstumsrate (1,072%)<br />
aufweist, wobei die Überlebensrate der Jungvögel und der Bruterfolg subadulter und<br />
adulter Weibchen am wichtigsten sind. Bei Szenario a) ergibt sich eine stabile Population,<br />
die Wachstumsrate liegt bei 1,001%. Erhöht man die Auftretenswahrscheinlichkeit für<br />
schneereiche Winter auf alle 5 Jahre, so liegt die Wachstumsrate nur noch bei 0,935% und<br />
das Aussterberisiko nach 25 Jahren bei 11,6%. Nimmt man für Szenario b) die<br />
beobachteten Verhältnisse (Alpes Maritimes, 1982 bis 1997) von 0,3 : 0,5 : 0,2 an, so liegt<br />
die Wachstumsrate bei 0,969%. Stabile Verhältnisse sind mit dieser Methode erst bei der<br />
hypothetischen Ausgangslage 0,5 : 0,3 : 0,2 zu erreichen, ein Wachsutm bei 0,4 : 0,5 : 0,1.<br />
Szenario b) kommt also zu etwas geringeren Wachstumsraten. Bis hierher stimmen die<br />
Ergebnisse gut mit den von BERNARD-LAURENT & LÉONARD (2000) empirisch ermittelten<br />
Bestandszahlen überein. Szenario c) ergibt (bei einem Verhältnis von 0,3 : 0,5 : 0,2 eine<br />
Wachstumsrate von 0,906% und 27,1% Aussterbewahrscheinlichkeit. Die wohl etwas zu<br />
stark negative Tendenz könnte durch eine zu kleine Stichprobe (n = 37) oder einige der<br />
eingangs genannten Fehlerquellen verursacht sein.<br />
Als Fazit weisen BERNARD-LAURENT & LÉONARD (2000) auf eine ausreichende<br />
Vernetzung der Populationen in den Französischen Südalpen hin, dort bestehe kein reales<br />
Aussterberisiko. Am Nordwestrand der Verbreitung, wo Verluste nicht über<br />
Populationsaustausch aufgefangen werden können, bestehe aber ein akutes<br />
Aussterberisiko. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass es keine<br />
Einschätzungen über die Mindestgröße einer überlebensfähigen Population (minimum viable<br />
population – MVP) für das Steinhuhn gibt. Dabei handelt es sich um ein generelles Problem<br />
des Artenschutzes (SOULÉ 1987). Eine fundierte Einschätzung einer MVP kann nur unter<br />
Berücksichtigung von sowohl populationsbezogenen Faktoren (Reproduktion, Mortalität,<br />
Mobilität etc.) als auch von Umwelteinflüssen (Habitatqualität, Anfälligkeit gegenüber<br />
Klimaeinflüssen etc.) erfolgen. Dies war im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu<br />
bewerkstelligen. Wichtige Hinweise zur Mobilität der Art geben aber Telemetrie-Studien<br />
von HAFNER (1994) und BERNARD-LAURENT (1991). Demnach können zwischen den<br />
Sommer- und Winterhabitaten des Steinhuhns zwischen 6 bis 9 km liegen, in Extremfällen<br />
sogar bis zu 25 km. Dabei werden unterschiedliche Täler und Berggruppen angeflogen.