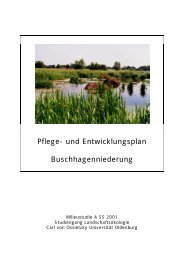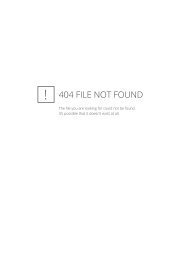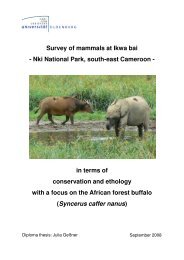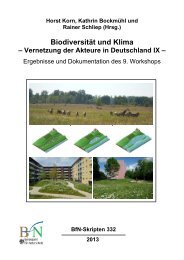DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6 Diskussion 59<br />
maximale Neigung von 58° festgestellt, Neugradklassen oberhalb der Stufe 13 (entspricht<br />
54-58,4 Altgrad, siehe Anh. 1.2) dürften also in der Realität kaum besiedelt werden. Bei der<br />
Neigung handelt es sich aber wohl um keinen direkten Zusammenhang mit dem<br />
Vorkommen des Steinhuhns. Sowohl LÜPS (1978) als auch HAFNER (1994) betonen den<br />
Einfluss der Neigung (in Verbindung mit der Exposition) auf ein frühes Ausapern (je<br />
steiler, desto höher die Sonneneinstrahlung, desto weniger setzt sich Schnee fest, da er<br />
leichter abrutscht). Schneefreie Flächen sind für den wenig an den Hochwinter angepassten<br />
Standvogel (LÜPS 1981b, GOSSOW et al. 1992, SCHMID et al. 1998) von entscheidender<br />
Bedeutung. Außerdem weisen steile Hänge oft die für das Steinhuhn vorteilhafte<br />
Verbindung von krautiger Vegetation, Offenboden und Fels auf (HAFNER 1994). Bei der<br />
„Exposition“ findet sich nach den Literaturangaben eine noch stärkere Spezialisierung als<br />
bei der Neigung (84% aller Beobachtungen zwischen SE und SW (ZBINDEN 1984)). Da<br />
aber pro Kilometerquadrat nur eine dominante Exposition errechnet wurde und außerdem<br />
kleine, geeignete Bereiche mit Steinhuhnvorkommen einer ansonsten überwiegend<br />
„ungünstig“ ausgerichteten Rasterzelle dieser komplett ein „Vorkommen“ zuweisen, zeigt<br />
sich auf dieser Skalenebene nur ein schwacher Zusammenhang. Eine Bevorzugung von<br />
südlich ausgerichteten Hängen lässt sich aber dennoch erkennen (Abb. 10).<br />
Fast alle der Nutzungsparameter zeigen einen unimodalen Kurvenverlauf (Abb. 11). Dies<br />
deutet darauf hin, dass die Art mosaikartige Strukturen bevorzugt. Selbst eindeutig positiv<br />
mit dem Steinhuhnvorkommen korrelierte Parameter („Alpweiden“ oder „Unproduktive<br />
Vegetation“) zeigen bei zu hohen Flächenanteilen einen negativen Einfluss auf die<br />
Vorkommenswahrscheinlichkeit. Die Häufigkeitsklasse „vorhanden, aber nicht<br />
dominierend“ wird auch von LÜPS & HEYNEN (1978) als bevorzugter Deckungsgrad<br />
angegeben. Lediglich „Geschlossene Wälder“ werden eindeutig gemieden. „Aufgelöste<br />
Wälder“ und „Gebüschwälder“ sind dagegen bis zu Flächenanteilen von gut 20% an der<br />
Rasterzelle positiv mit dem Steinhuhnvorkommen korreliert. Die Definition der beiden<br />
Nutzungstypen (Anh. 1.3) präzisiert die geringe Deckung der „Aufgelösten Wälder“ (20-<br />
60%) und nennt Grünerlengebüsche an der Waldgrenze im Alpenraum als eine der<br />
häufigsten Ausprägung der „Gebüschwälder“. Dies passt zu Beobachtungen von ZBINDEN<br />
(1984) und BOCCA (1990), die das Vorhandensein eines lockeren Baumbestandes als zwar<br />
nicht notwendig, aber durchaus günstig für die Art einstufen. In der Regel werden<br />
Deckungsgrade von 20 (POMPILIO et al. 2003) bis maximal 30 oder 40% akzeptiert (BOCCA<br />
1990). Das Vorkommen von Steinhühnern bei aufkommendem Grünerlenbewuchs wird<br />
von PRÄSENT (1979) bestätigt und die Eignung von Grünerlengebüschen als Äsungsgebiete<br />
im Frühjahr wird von HAFNER (1994) beschrieben. Genutzt werden Einzelbäume und<br />
Büsche vor allem als Schutz- und Schattenspender für Ruhe- und Schlafphasen (LÜPS &<br />
HEYNEN 1978, BOCCA 1990, ZBINDEN & SALVIONI 2003). Der Nutzungstyp „Alp- und<br />
Juraweiden“ entspricht dem von vielen Autoren als für die Art günstig beschriebenen<br />
Mosaik aus Weideflächen, die mit Büschen, Trockenmauern, Zäunen und Felsen<br />
durchsetzt sind (BOCCA 1990, GOSSOW et al. 1992, HAFNER 1994). Diese Bereiche werden