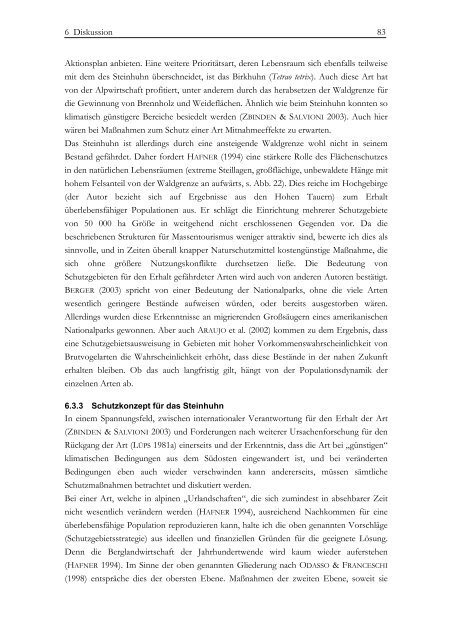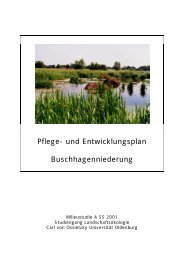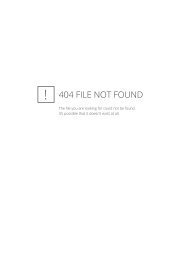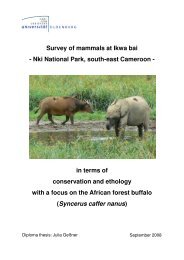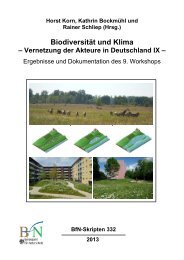DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6 Diskussion 83<br />
Aktionsplan anbieten. Eine weitere Prioritätsart, deren Lebensraum sich ebenfalls teilweise<br />
mit dem des Steinhuhn überschneidet, ist das Birkhuhn (Tetrao tetrix). Auch diese Art hat<br />
von der Alpwirtschaft profitiert, unter anderem durch das herabsetzen der Waldgrenze für<br />
die Gewinnung von Brennholz und Weideflächen. Ähnlich wie beim Steinhuhn konnten so<br />
klimatisch günstigere Bereiche besiedelt werden (ZBINDEN & SALVIONI 2003). Auch hier<br />
wären bei Maßnahmen zum Schutz einer Art Mitnahmeeffekte zu erwarten.<br />
Das Steinhuhn ist allerdings durch eine ansteigende Waldgrenze wohl nicht in seinem<br />
Bestand gefährdet. Daher fordert HAFNER (1994) eine stärkere Rolle des Flächenschutzes<br />
in den natürlichen Lebensräumen (extreme Steillagen, großflächige, unbewaldete Hänge mit<br />
hohem Felsanteil von der Waldgrenze an aufwärts, s. Abb. 22). Dies reiche im Hochgebirge<br />
(der Autor bezieht sich auf Ergebnisse aus den Hohen Tauern) zum Erhalt<br />
überlebensfähiger Populationen aus. Er schlägt die Einrichtung mehrerer Schutzgebiete<br />
von 50 000 ha Größe in weitgehend nicht erschlossenen Gegenden vor. Da die<br />
beschriebenen Strukturen für Massentourismus weniger attraktiv sind, bewerte ich dies als<br />
sinnvolle, und in Zeiten überall knapper Naturschutzmittel kostengünstige Maßnahme, die<br />
sich ohne größere Nutzungskonflikte durchsetzen ließe. Die Bedeutung von<br />
Schutzgebieten für den Erhalt gefährdeter Arten wird auch von anderen Autoren bestätigt.<br />
BERGER (2003) spricht von einer Bedeutung der Nationalparks, ohne die viele Arten<br />
wesentlich geringere Bestände aufweisen würden, oder bereits ausgestorben wären.<br />
Allerdings wurden diese Erkenntnisse an migrierenden Großsäugern eines amerikanischen<br />
Nationalparks gewonnen. Aber auch ARAUJO et al. (2002) kommen zu dem Ergebnis, dass<br />
eine Schutzgebietsausweisung in Gebieten mit hoher Vorkommenswahrscheinlichkeit von<br />
Brutvogelarten die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Bestände in der nahen Zukunft<br />
erhalten bleiben. Ob das auch langfristig gilt, hängt von der Populationsdynamik der<br />
einzelnen Arten ab.<br />
6.3.3 Schutzkonzept für das Steinhuhn<br />
In einem Spannungsfeld, zwischen internationaler Verantwortung für den Erhalt der Art<br />
(ZBINDEN & SALVIONI 2003) und Forderungen nach weiterer Ursachenforschung für den<br />
Rückgang der Art (LÜPS 1981a) einerseits und der Erkenntnis, dass die Art bei „günstigen“<br />
klimatischen Bedingungen aus dem Südosten eingewandert ist, und bei veränderten<br />
Bedingungen eben auch wieder verschwinden kann andererseits, müssen sämtliche<br />
Schutzmaßnahmen betrachtet und diskutiert werden.<br />
Bei einer Art, welche in alpinen „Urlandschaften“, die sich zumindest in absehbarer Zeit<br />
nicht wesentlich verändern werden (HAFNER 1994), ausreichend Nachkommen für eine<br />
überlebensfähige Population reproduzieren kann, halte ich die oben genannten Vorschläge<br />
(Schutzgebietsstrategie) aus ideellen und finanziellen Gründen für die geeignete Lösung.<br />
Denn die Berglandwirtschaft der Jahrhundertwende wird kaum wieder auferstehen<br />
(HAFNER 1994). Im Sinne der oben genannten Gliederung nach ODASSO & FRANCESCHI<br />
(1998) entspräche dies der obersten Ebene. Maßnahmen der zweiten Ebene, soweit sie