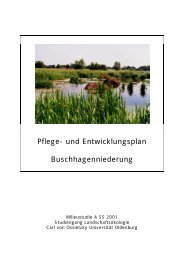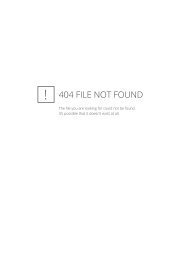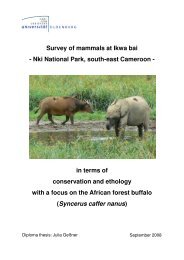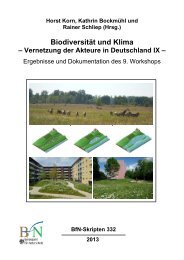DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 Diskussion 57<br />
Nahrung oder Versteckmöglichkeiten) und Umwelteinflüssen (wie Temperatur oder<br />
Niederschlag), die Ansiedlung von Individuen oder Populationen möglich ist (MORRISON<br />
et al. 1998). Für das Überleben der Art sind natürlich auch die Jungenaufzuchtgebiete<br />
(ZBINDEN, mündl. Mitt.) oder die Schutzmöglichkeiten im Winter von Bedeutung, für<br />
diese müssten aber gesonderte Modelle erstellt werden. Ob die Brutzeit-Modelle den für<br />
das Überleben der Art entscheidenden Zeitraum repräsentieren, ist aber nicht sicher.<br />
BERNARD-LAURENT & LÉONARD (2000) zeigen aber durch Modellierung, dass neben der<br />
Überlebensrate der Jungvögel der Bruterfolg die Wachstumsrate beim Steinhuhn am<br />
meisten beeinflusst.<br />
Atlasmodell<br />
Bei der univariaten Analyse wurden 15 Variablen aus verschiedenen Gründen nicht<br />
weiter berücksichtigt, davon genügten neun den Aufnahmekriterien nicht. Bei einigen<br />
dieser Parameter wurde ein stärkerer Einfluss auf das Steinhuhnvorkommen erwartet. Die<br />
Exposition gilt allgemein als wichtiger Faktor bei der Habitatwahl des Steinhuhns. Die<br />
„Sinustransformierte Exposition“ repräsentiert dabei den Ost-West-Gradienten. In der<br />
Literatur existieren dazu widersprüchliche Angaben. So spricht LÜPS (1980) von einer<br />
hochsignifikanten Bevorzugung von SE und E gegenüber SW und W, ZBINDEN (1984)<br />
und HAFNER (1994) kamen dagegen zu dem Ergebnis, dass SW-Hänge eher besiedelt<br />
werden. In der vorliegenden Arbeit wird ebenfalls eine Bevorzugung der westlichen<br />
Richtungen festgestellt (vgl. Vorzeichen des Regressionskoeffizienten in Anh. 2.3), der<br />
Zusammenhang zum Steinhuhnvorkommen ist aber nicht stark. Der Nutzungstyp<br />
„Maiensässe, Heualpen und Bergwiesen“ scheint den Strukturen, deren Verschwinden<br />
ZBINDEN (1984) und GLUTZ et al. (1973) als Verlust an Brutlebensraum bewerten, zu<br />
entsprechen. Bei genauerer Betrachtung der Definition der Nutzungstypen (Anhang 1.3)<br />
fällt aber auf, dass eher die „Alp- und Juraweiden“ das für die Art günstige Mosaik aus<br />
offenen Flächen, Felsen und Büschen aufweisen. Niedrige Vegetation ist zwar in allen<br />
Brutgebieten der Art vertreten (HAFNER 1994), die Auswertung der Strukturkartierung für<br />
das Regionalmodell zeigt aber, dass eine zu hohe Deckung der Krautschicht negativ mit<br />
dem Vorkommen des Steinhuhns zusammenhängt (Abb. 16). Die geringe Modellgüte des<br />
Parameters „Dichte, niedrige Vegetation“ ist somit verständlich. Die relativ schwachen<br />
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Waldtypen und dem Vorkommen der Art<br />
kommen eventuell durch deren Höhenverbreitung zustande. So können gerade in<br />
Kilometerquadraten mit großer Höhenamplitude an der oberen Grenze Steinhühner<br />
vorkommen, während die unteren Bereiche bewaldet sind. Dadurch wird der an sich<br />
negative Zusammenhang zwischen Waldtyp und Steinhuhn (vgl. Anh. 2.3) weniger<br />
deutlich.<br />
Sechs weitere Variablen wurden wegen Korrelation mit anderen Parametern<br />
ausgeschlossen. Die Parameter „Bewölkungsgrad im Juli“ und „Niederschlagssumme im<br />
Juli“ werden durch die „Wasserbilanz im Juli“ vertreten. Der Zusammenhang zum<br />
Steinhuhnvorkommen ist für letztgenannte stärker. Die Variable wird auch von BOLLIGER