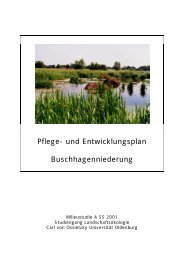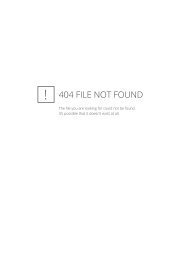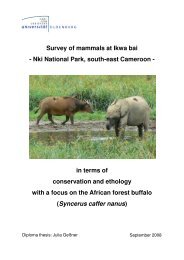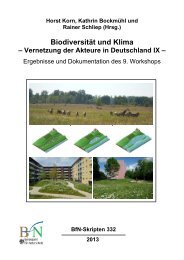DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6 Diskussion 76<br />
„Gebüschwald“ weist in der Modellierung der vorliegenden Arbeit auf nationalem Maßstab<br />
bis zu einem Flächenanteil an der Rasterfläche von knapp 30% einen positiven<br />
Zusammenhang mit dem Vorkommen des Steinhuhns auf (Abb. 11). Die<br />
Zusammensetzung des Nutzungstyps mit den Hauptarten Alnus viridis, Pinus mugo und<br />
Corylus avellana verdeutlicht, dass es sich hierbei kaum um Bruthabitate für das Steinhuhn<br />
handelt (HAFNER 1994). Im Frühling können Erlengebüsche aber durchaus zur Äsung<br />
genutzt werden (HAFNER 1994) und sind aus Sicht des Steinhuhns positiver zu bewerten<br />
als beispielsweise „Geschlossene Wälder“.<br />
Eine mögliche Kompensation klimabedingter „Verluste“ an der unteren<br />
Lebensraumgrenze durch gleichzeitigen „Gewinn“ an Lebensraum durch Entstehung neuer<br />
Alpiner Matten auf aktuell vegetationslosen Flächen wird durch den „Gipfeleffekt“ (nichtplanimetrisches<br />
Verhalten der Flächen im Hochgebirge im Vergleich zu großen Flächen in<br />
tieferen Lagen) eingeschränkt, zumal zuerst eine komplette Bodenentwicklung stattfinden<br />
muss.<br />
Die Temperaturveränderung, welche zur Zunahme der Waldfläche und somit zu<br />
Habitatverlusten beim Steinhuhn führen könnte, wird auch die Niederschlagshäufigkeit<br />
(insbesondere Starkregenereignisse) um durchschnittlich 20% ansteigen lassen (BOLLIGER<br />
2002). Dies kann zu weiteren Bestandseinbußen führen (vgl. Kap. 6.3.1).<br />
Bei der Diskussion um die Entwicklung der Waldgrenze und den Einfluss auf den<br />
Lebensraum darf aber nicht vergessen werden, dass es sich beim Steinhuhn um einen<br />
Vertreter des turkestanisch-ostmediterranen Faunenelements handelt. Natürliche Prozesse<br />
führten im Alpenraum zur Verdrängung das Steinhuhn seit dem Ende der Eiszeit durch<br />
den sukzessiven Anstieg der Waldgrenze in die Krüppelzone und andere Randbereiche<br />
(LÜPS 1981b, HAFNER 1994). Erst der Mensch hat durch Rodungen und Weidebetrieb der<br />
Art unterhalb der Waldgrenze großflächig Lebensraum erschlossen (vgl. Kap. 6.3.1). Eine<br />
Rückentwicklung dieser Eingriffe muss zu Veränderungen im Steinhuhnbestand führen<br />
(HAFNER 1994). In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die nach der<br />
vorliegenden Analyse bevorzugte Julitemperatur (10° C, Abb. 10) sehr gut mit der<br />
potentiellen Waldgrenze übereinstimmt. Dies deutet darauf hin, dass die Art eventuell „mit<br />
der Waldgrenze ansteigen“ könnte. Sollte die bereits beschriebene „Versteppung“ der<br />
zentralalpinen Täler tatsächlich eintreten, so kann sich außerdem der von PRÄSENT (1979)<br />
formulierte Nachteil eines „Einwanderers aus dem Südosten, ursprünglich ein Bewohner<br />
von Halbwüsten und Steppen ohne besondere Anpassungen an das rauhe Klima“ auch<br />
zum Vorteil entwickeln. Beobachtungen aus dem Apennin und Sizilien zeigen, dass bei<br />
dem dortigen Klima die Bindung an südexponierte Hänge und bestimmte Höhenstufen<br />
weniger stark oder gar nicht mehr feststellbar ist (DE FRANCESCHI 1994). Dem steht<br />
allerdings die Möglichkeit einer Zunahme von Starkregenereignissen entgegen.<br />
Die Bewertung klimabedingter Veränderungen in der Artenzusammensetzung wird<br />
gegenwärtig kontrovers diskutiert. Das Verschwinden von Arten kann als natürlicher<br />
Prozess angesehen werden. STRIEN (1997) sieht in seiner Arbeit zu einem