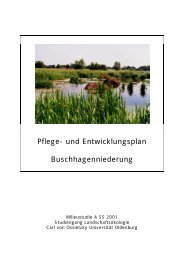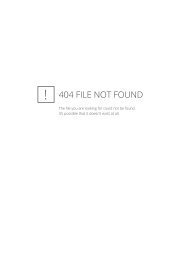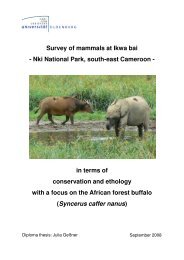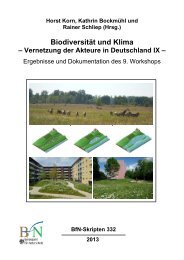DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 Diskussion 60<br />
außer im Winter z.T. auch zur Brutzeit genutzt. Die „Unproduktive Vegetation“ schließt<br />
mit zunehmender Höhe direkt an den vorgenannten Bereich an und ist der für das<br />
Vorkommen des Steinhuhns wichtigste Nutzungstyp. Bei der Definition in Anhang 1.3<br />
werden entscheidende Strukturelemente genannt. Gras- und Krautvegetation sowie<br />
Zwergstrauchvegetation sind die meistgenannten Vegetationseinheiten bei der<br />
Beschreibung der Steinhuhnhabitate (HESS 1979, ZBINDEN 1984, SCHMID et al. 1998).<br />
Einzelne Gebüsche und ehemaliges Kulturland können die Vorkommenswahrscheinlichkeit<br />
erhöhen (s.o.). Auch die „Vegetationslosen Flächen“ bis zu einem Flächenanteil<br />
von etwa 25% hängen mit dem Steinhuhnvorkommen positiv zusammen. Dieser Anteil<br />
scheint ein wenig hoch, HAFNER (1994) gibt für den Brutzeitraum einen<br />
Gesamtdeckungsgrad der Vegetation von 80-90% an.<br />
Die Vegetationsparameter weisen insgesamt eher geringe Erklärungsgehalte auf (Tab. 8),<br />
es lassen sich aber eindeutige Tendenzen feststellen. Der Strukturtyp „Dichte, höhere<br />
Gras- und Seggenfluren“ zeigt einen negativen Zusammenhang mit dem<br />
Steinhuhnvorkommen. Dies stimmt mit der von LÜPS (1981b) beschriebenen „Meidung<br />
dichter und hoher Pflanzendecken“ überein. Dass der Strukturtyp „Staudenfluren“ positiv<br />
mit dem Vorkommen der Art übereinstimmt, überrascht. Der Deckungsgrad von 75%, der<br />
in Abbildung 12 die höchsten Vorkommenswahrscheinlichkeiten verursacht, tritt in der<br />
Realität aber kaum auf und nur in einem Fall liegt in der entsprechenden Rasterzelle auch<br />
ein Vorkommen des Steinhuhns. Es scheint sich hier also, wie schon bei der „Exposition“<br />
beschrieben, um Artefakte zu handeln, welche durch die hohe Heterogenität der<br />
Kilometerquadrate zustande kommen. Es kann sich auch um Einflüsse der jahreszeitlichen<br />
Entwicklung handeln, denn wie HAFNER (1994) bemerkt, können Staudenfluren im<br />
Frühjahr, wenn nach der Schneeschmelze durch die niedergedrückten Pflanzenteile neues<br />
Grün hervorkommt, durchaus als Äsungsgebiete geeignet sein, im Sommer werden sie<br />
dann aber gemieden. Aus diesem Grund wurden die „Staudenfluren“ bei der Erstellung der<br />
multiplen Modelle berücksichtigt. Neben der krautigen Vegetation sind die<br />
„Zwergsträucher und niedrigen Gebüsche“ die wichtigsten Vegetationseinheiten für die<br />
Steinhühner. Zu hohe Deckungen werden dabei gemieden (Abb. 12). „Höhere Gebüsche“<br />
dagegen sind eindeutig negativ mit dem Vorkommen der Art korreliert. Auch GLUTZ et al.<br />
(1973), ZBINDEN (1984), und HAFNER (1994) bestätigen, dass Zwergstrauchgesellschaften<br />
geringer Dichte (bis ca. 15%) zu den Charakteristika der Steinhuhnhabitate gehören,<br />
während eine dominierende Strauchschicht gemieden wird (LÜPS & HEYNEN 1978). Der<br />
negative Einfluss des Strukturtyps „Gras-, Hochstauden-, Kraut-, oder Zwergstrauchreiche<br />
Laubwälder“ stimmt mit den Überlegungen im Zusammenhang mit dem Nutzungstyp<br />
„Geschlossener..Wald“..(s.o.)..überein.<br />
Als bestes multiples Modell des Modellblocks für den maximalen Informationsgewinn<br />
wurde Modell A1-1 ermittelt (Tab. 12). Es berücksichtigt Parameter aus allen Bereichen<br />
(Klima, Geostatistik, Nutzung und Vegetation). Das optimale Bruthabitat ließe sich<br />
demnach als warm-trockene, südexponierte Mosaiklandschaft aus überwiegend