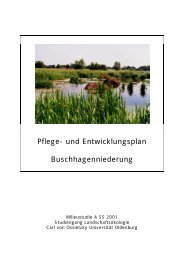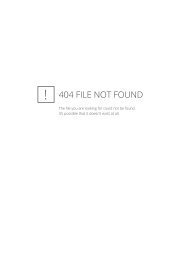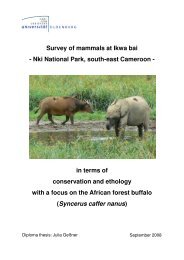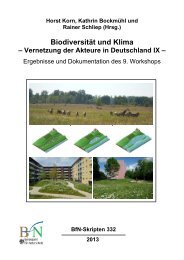DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
DIPLOMARBEIT - Universität Oldenburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 Diskussion 65<br />
Geostatistik wurde nur die „Cosinustransformierte Exposition“ in der multiplen Analyse<br />
berücksichtigt. Es zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Südausrichtung und<br />
Steinhuhnvorkommen (Abb. 16). Eine eindeutige Bevorzugung von Südexpositionen<br />
nennen auch GLUTZ et al. (1973), LÜPS (1980) und SCHMID et al. (1998). ZBINDEN (1984)<br />
stellte nördliche Ausrichtungen nur bei 3% fest (s. auch BOCCA (1991)).<br />
Nur zwei Nutzungstypen zeigten einen signifikanten Zusammenhang mit dem<br />
Steinhuhnvorkommen, davon entsprach nur die „Unproduktive Vegetation“ den<br />
Aufnahmekriterien. Schon bei der Modellierung zum Atlasmodell hatte diese Variable<br />
einen stark positiven Einfluss, die dort genannten Argumente werden durch das Ergebnis<br />
auf der Skalenebene des Regionalmodells bekräftigt.<br />
Die Ausprägung der Vegetation spielt bei der Habitatwahl des Steinhuhns eine<br />
entscheidende Rolle. Dabei scheinen weniger bestimmte Vegetationseinheiten wichtig zu<br />
sein, als vielmehr die Vegetationszusammensetzung der Umgebung und bestimmte<br />
Vegetationsstrukturen. Nur ein Strukturtyp genügte den Aufnahmekriterien für die multiple<br />
Modellierung. Die „Zwergsträucher und niedrigen Gebüsche“ wurden bereits bei der<br />
Diskussion der Atlas-Parameter als wichtige Einheiten für das Steinhuhnvorkommen<br />
genannt. Der negative Einfluss zu hoher Deckungsgrade (HAFNER 1994) wird allerdings<br />
wenig deutlich (Abb. 16). Die Umgebungsvariable „Nachbarvegetation“ ist positiv mit dem<br />
Vorkommen der Art korreliert und zeigt einen starken Einfluss auf die<br />
Vorkommenswahrscheinlichkeit. Dies bedeutet, dass auch in der näheren Umgebung der<br />
Steinhuhnvorkommen eine für die Art günstige Vegetationszusammensetzung vorhanden<br />
sein muss, bzw. dass der untersuchte Ausschnitt des Aktions- und Lebensraumes nicht<br />
unabhängig von der Beschaffenheit der Umgebung ist. Die Vorkommenswahrscheinlichkeit<br />
steigt dabei, wenn die Anzahl der Strukturtypen steigt, die in der univariaten<br />
Analyse einen positiven Zusammenhang mit dem Steinhuhnvorkommen aufweisen. Die<br />
Ergebnisse könnten durch die teilweise unterschiedliche Probeflächengröße verzerrt<br />
werden. Da ich aber alle Flächen standardisiert auf Basis der Homogenität ausgewählt<br />
habe, ist die Vergleichbarkeit gewährleistet. Die „Deckung der Waldschicht“ zeigt einen<br />
sehr starken, negativen Einfluss. Bereits bei einem Deckungsgrad von etwa 8% geht die<br />
Vorkommenswahrscheinlichkeit gegen Null (Abb. 16). Dies stimmt zwar mit den<br />
Beobachtungen von GLUTZ et al. (1973) und ZBINDEN (1984) überein, die geschlossene<br />
Wälder mit stark gestörtem Rasenunterwuchs als gemiedene Bereiche<br />
bezeichnen, allerdings gilt dies nach BOCCA (1990) erst ab einem Deckungsgrad von 30-<br />
40%. Die Deckung der Krautschicht mit einem Optimum bei 75% (Abb. 16) dagegen<br />
entspricht relativ genau den Literaturangaben. So gibt HAFNER (1994) einen<br />
Gesamtdeckungsgrad von 60-70% im Frühjahr und 80-90% im Sommer an, wobei der<br />
Anteil der Krautschicht ganzjährig dominiert. Bei LÜPS & HEYNEN (1978) gehörte „die ½<br />
oder mehr des Bodens bedeckend aber nicht dominierend“ zu den am häufigsten<br />
auftretenden Deckungsklassen. Die „Mittlere Höhe der Krautschicht“ mit einem Optimum<br />
bei 20 cm passt exakt zu Beobachtungen, die BOCCA (1990) bei Untersuchungen im