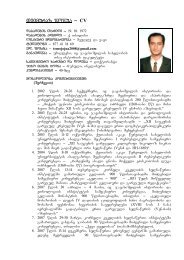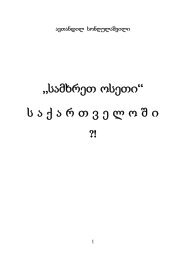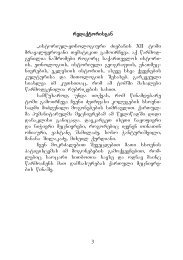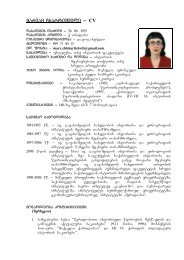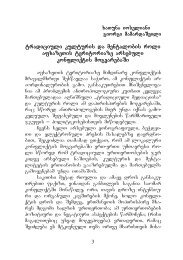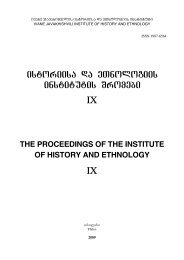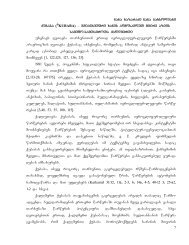programa "logosi"
programa "logosi"
programa "logosi"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sylvia Hutter-Braunsar (Alfter)<br />
BEGEGNUNGEN AM OBEREN EUPHRAT – URARTÄER<br />
UND LUWIER IN OSTANATOLIEN<br />
Der durch diesen Band Geehrte hat in seinen zahlreichen Arbeiten die<br />
Sprache und Kultur der Urartäer erforscht. Unter anderem hat er durch seine<br />
grundlegende Bearbeitung der urartäischen Inschriften den Grundstein für<br />
die Miteinbeziehung dieser wichtigen Quellen für die Erforschung der Geschichte<br />
dieses Reiches gelegt. In diesem Beitrag sollen die historischen<br />
Beziehungen der Urartäer zu ihren westlichen Nachbarn nachgezeichnet<br />
werden.<br />
1. Politisch-militärische Kontakte<br />
Die sog. späthethitischen Fürstentümer etablierten sich nach dem Zusammenbruch<br />
des Hethiterreiches in jenem Raum in Südostanatolien und<br />
Nordsyrien, der spätestens seit der Mitte des zweiten Jahrtausends v.Chr.<br />
von hurritischen und luwischen Bevölkerungselementen bewohnt war. Am<br />
weitesten im Osten 1 dieser Kleinstaaten lagen Malatya (urartäisch Meliṭeia,<br />
assyrisch Melid), Kommagene (urartäisch Qumaha, luwisch Kumaha, assyrisch<br />
Kummuḫ), Maraş (luwisch Kurkuma(wani)-, assyrisch Gurgum/Marqaš),<br />
und Karkamiš (luwisch Karkamis, assyrisch Gargamis). 2<br />
Östlich davon etablierte sich im neunten Jahrhundert das Reich Urartu. 3 Aus<br />
beiden Kulturbereichen sind uns etliche Inschriften überliefert, meist von<br />
Herrschern, die in Weiheinschriften auch über ihre militärischen Erfolge<br />
berichten. 4 Bevor nun das Urartäerreich sich so weit nach Westen ausbreitete,<br />
dass es in direkten Kontakt zu den späthethitischen Fürstentümern<br />
kam, geriet es im Süden in Konflikt mit den Assyrern, die – bereits zur Zeit<br />
des hethitischen Großreiches – ab Tukulti-Ninurta I. (1233-1197) ihren<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Vgl. dazu beispielsweise die Karten in Röllig / Fuchs 2002, 1027 oder Salvini 1995, 242-<br />
252.<br />
Zur Geschichte dieser Fürstentümer vgl. die jeweiligen Kapitel bei Hawkins 2000 und ders.<br />
1982.<br />
Eine Einführung in Geschichte und Kultur findet sich in Salvini 1995.<br />
Die urartäischen Inschriften sind von G. Melikišvili (1960 = UKN) und F. W. König (1955<br />
= HchI) bearbeitet, eine Neuedition ist von M. Salvini (2003, 209 mit Anm. 2) angekündigt.<br />
Das Korpus der urartäischen Inschriften von Nikolay Harouthiounyan (Erevan 2001) ist mir<br />
nicht zugänglich, vgl. aber dazu die ausführliche Besprechung von Salvini 2001. Die in diesem<br />
Zusammenhang interessanten hieroglyphenluwischen Texte finden sich bei Hawkins<br />
2000. Vgl. zu diesen auch Cancik 2002.<br />
77