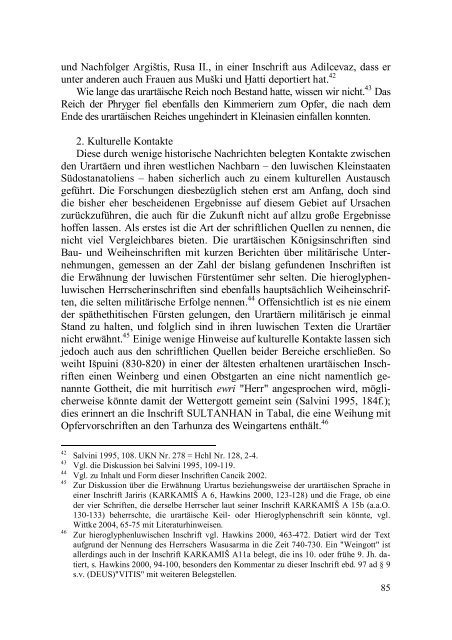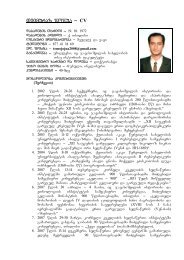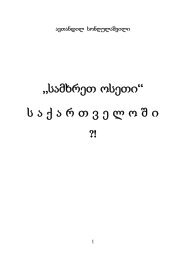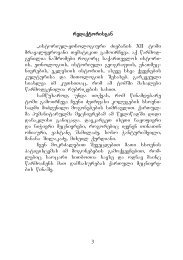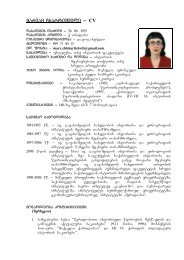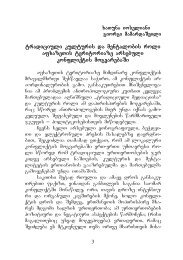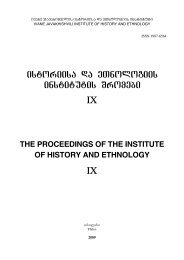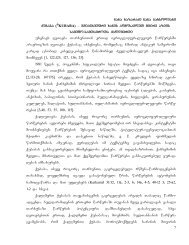programa "logosi"
programa "logosi"
programa "logosi"
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
und Nachfolger Argištis, Rusa II., in einer Inschrift aus Adilcevaz, dass er<br />
unter anderen auch Frauen aus Muški und Ḫatti deportiert hat. 42<br />
Wie lange das urartäische Reich noch Bestand hatte, wissen wir nicht. 43 Das<br />
Reich der Phryger fiel ebenfalls den Kimmeriern zum Opfer, die nach dem<br />
Ende des urartäischen Reiches ungehindert in Kleinasien einfallen konnten.<br />
2. Kulturelle Kontakte<br />
Diese durch wenige historische Nachrichten belegten Kontakte zwischen<br />
den Urartäern und ihren westlichen Nachbarn – den luwischen Kleinstaaten<br />
Südostanatoliens – haben sicherlich auch zu einem kulturellen Austausch<br />
geführt. Die Forschungen diesbezüglich stehen erst am Anfang, doch sind<br />
die bisher eher bescheidenen Ergebnisse auf diesem Gebiet auf Ursachen<br />
zurückzuführen, die auch für die Zukunft nicht auf allzu große Ergebnisse<br />
hoffen lassen. Als erstes ist die Art der schriftlichen Quellen zu nennen, die<br />
nicht viel Vergleichbares bieten. Die urartäischen Königsinschriften sind<br />
Bau- und Weiheinschriften mit kurzen Berichten über militärische Unternehmungen,<br />
gemessen an der Zahl der bislang gefundenen Inschriften ist<br />
die Erwähnung der luwischen Fürstentümer sehr selten. Die hieroglyphenluwischen<br />
Herrscherinschriften sind ebenfalls hauptsächlich Weiheinschriften,<br />
die selten militärische Erfolge nennen. 44 Offensichtlich ist es nie einem<br />
der späthethitischen Fürsten gelungen, den Urartäern militärisch je einmal<br />
Stand zu halten, und folglich sind in ihren luwischen Texten die Urartäer<br />
nicht erwähnt. 45 Einige wenige Hinweise auf kulturelle Kontakte lassen sich<br />
jedoch auch aus den schriftlichen Quellen beider Bereiche erschließen. So<br />
weiht Išpuini (830-820) in einer der ältesten erhaltenen urartäischen Inschriften<br />
einen Weinberg und einen Obstgarten an eine nicht namentlich genannte<br />
Gottheit, die mit hurritisch ewri "Herr" angesprochen wird, möglicherweise<br />
könnte damit der Wettergott gemeint sein (Salvini 1995, 184f.);<br />
dies erinnert an die Inschrift SULTANHAN in Tabal, die eine Weihung mit<br />
Opfervorschriften an den Tarhunza des Weingartens enthält. 46<br />
42<br />
43<br />
44<br />
45<br />
46<br />
Salvini 1995, 108. UKN Nr. 278 = HchI Nr. 128, 2-4.<br />
Vgl. die Diskussion bei Salvini 1995, 109-119.<br />
Vgl. zu Inhalt und Form dieser Inschriften Cancik 2002.<br />
Zur Diskussion über die Erwähnung Urartus beziehungsweise der urartäischen Sprache in<br />
einer Inschrift Jariris (KARKAMIŠ A 6, Hawkins 2000, 123-128) und die Frage, ob eine<br />
der vier Schriften, die derselbe Herrscher laut seiner Inschrift KARKAMIŠ A 15b (a.a.O.<br />
130-133) beherrschte, die urartäische Keil- oder Hieroglyphenschrift sein könnte, vgl.<br />
Wittke 2004, 65-75 mit Literaturhinweisen.<br />
Zur hieroglyphenluwischen Inschrift vgl. Hawkins 2000, 463-472. Datiert wird der Text<br />
aufgrund der Nennung des Herrschers Wasusarma in die Zeit 740-730. Ein "Weingott" ist<br />
allerdings auch in der Inschrift KARKAMIŠ A11a belegt, die ins 10. oder frühe 9. Jh. datiert,<br />
s. Hawkins 2000, 94-100, besonders den Kommentar zu dieser Inschrift ebd. 97 ad § 9<br />
s.v. (DEUS)"VITIS" mit weiteren Belegstellen.<br />
85