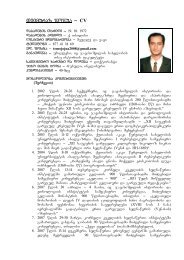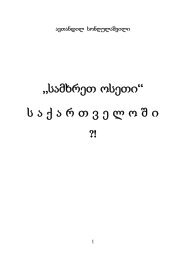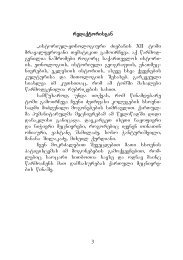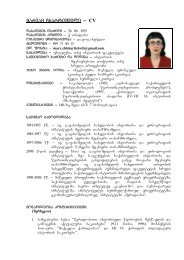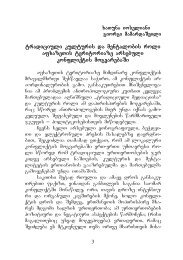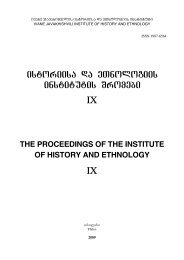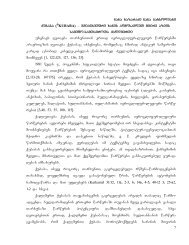programa "logosi"
programa "logosi"
programa "logosi"
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sucht (Işık 1995). Er konnte dabei vor allem Beziehungen zwischen Urartu<br />
und Phrygien feststellen, wobei die Phryger die Nehmenden waren. Dies hat<br />
seine Ursache darin, dass in beiden Kulturen Berge und Felsen als von<br />
göttlicher Kraft durchdrungen bzw. als Göttersitze angesehen wurden (Işık<br />
1995, 51). Wo sich hethitischer Einfluss in der urartäischen religiösen Architektur<br />
findet, ist er auf die Großreichszeit zurückzuführen und nicht auf<br />
Kontakte der Urartäer mit den späthethitischen Fürstentümern; so könnten<br />
beispielsweise die aus der hethitischen Großreichszeit stammenden Kammern<br />
1 und 2 von der Südburg in Hattusa mit der Funktion der Felskammer<br />
als Tempel bei den Urartäern in Verbindung stehen (Işık 1995, 55).<br />
In einem Beispiel jedoch wird der Kontakt ganz deutlich: Auf acht Pithoi<br />
in zwei Räumen einer Lagerhalle vom Altıntepe befinden sich hieroglyphenluwische<br />
Schriftzeichen, die urartäische Maßeinheiten wiedergeben,<br />
die sonst auch auf urartäischen Pithoi durchaus üblich sind, allerdings in<br />
urartäischer Keilschrift. 52 Die Pithoi sind vom normalen urartäischen Typ,<br />
wie sie in jeder urartäischen Siedlung vorkommen, und beinhalteten wahrscheinlich<br />
Wein. J. Klein (1974), der die Inschriften ediert hat, nimmt an,<br />
dass es sich beim Autor dieser Inschriften um einen luwischsprachigen<br />
Menschen handelte, der vielleicht gar nicht urartäisch sprechen – oder es<br />
zumindest nicht schreiben – konnte. Auf jeden Fall handelte es sich dabei<br />
aber um ein „isolated and short-lived phenomen" (Klein 1974, 93). Die<br />
Urartäer hatten zwar ebenfalls eine Hieroglyphenschrift geschaffen, allerdings<br />
ist diese noch nicht entziffert (Salvini 1995, 203-206). Es scheint sehr<br />
gut möglich, dass diese "Schrift" in Anlehnung an die in den späthethitischen<br />
Fürstentümern gebräuchliche hieroglyphenluwische Schrift entwickelt<br />
wurde. Vielleicht hat dasselbe Prestigebewusstsein zu deren Erfindung<br />
geführt, mit dem Jariri sich rühmt, zwölf Sprachen und vier Schriften zu<br />
beherrschen. Auch der spätere assyrische König Assurbanipal (668-631/27)<br />
konnte schreiben und lesen.<br />
Literatur:<br />
Aro, Sanna: Tabal. Zur Geschichte und materiellen Kultur des zentralanatolischen<br />
Hochplateaus von 1200 bis 600 v. Chr. PhD Dissertation<br />
University of Helsinki 1998.<br />
Bagg, Ariel M.: Die Orts- und Gewässernamen der neuassyrischen Zeit.<br />
Teil 1: Die Levante. Wiesbaden 2007 (= Répertoire Géographique<br />
des Textes Cunéiformes 7/1 = Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen<br />
Orients B 7/7/1).<br />
52<br />
S. dazu auch Reindell/Salvini 2001.<br />
87