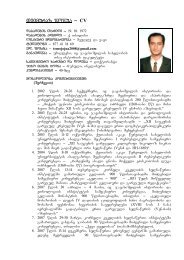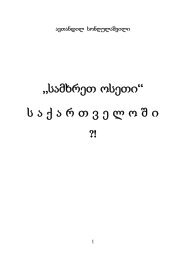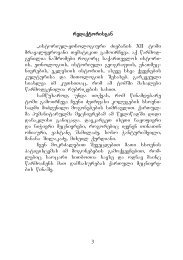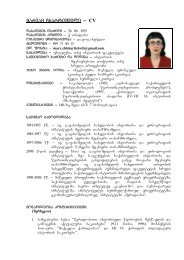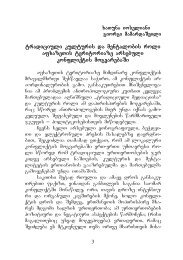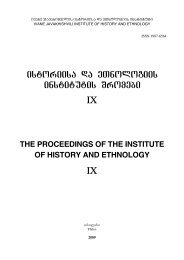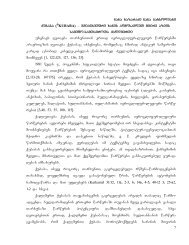programa "logosi"
programa "logosi"
programa "logosi"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
A. Kossian (1997) hat versucht, Beeinflussungen auf sprachlicher Ebene<br />
zu finden. Er führt drei Beispiele an: vom luwischen su(wa)- soll sich<br />
urartäsch šu- "füllen" herleiten; im luwischen Personennamen Sastura/i- soll<br />
der urartäische Name Sarduri fortleben; und das theophore Namenselement<br />
tisapa 47 soll der urartäischen Form Teišeba näher stehen als dem hurritischen<br />
Teššob. 48 Insgesamt sind diese Beispiele kein ausreichender Beweis<br />
für intensive sprachliche Kontakte. So sind wir auf archäologische Zeugnisse<br />
angewiesen. Aber auch hier sind die Vergleichsmöglichkeiten begrenzt<br />
und Gemeinsamkeiten nur punktuell erfassbar. So wurde für die<br />
Urartäer festgestellt, dass nach einer Phase der Aufgeschlossenheit äußeren<br />
Einflüssen gegenüber im neunten Jahrhundert, als auf dem Gebiet der Kunst<br />
und Politik Übernahmen aus dem assyrischen Bereich feststellbar sind, eine<br />
Phase der kulturellen Abschottung nach außen im achten und siebenten<br />
Jahrhundert erfolgte, und das ist jener Zeitraum, in den die Kontakte mit<br />
den luwischen Fürstentümern fallen. 49 J. Nieling untersuchte in seinem Beitrag<br />
zum Symposion "Die Außenwirkung des späthethitischen Kulturraumes"<br />
(2004) den urartäischen Bereich. Als einzigen Beleg für eine<br />
solche "Außenwirkung" kann er Motive auf urartäischen Gewandnadeln<br />
nennen, die sich als Götterattribute auf Orthostatenreliefs von Karkamiš und<br />
Malatya finden. 50 Umstritten ist die Herkunft großer Metallkessel mit sirenenförmigen<br />
Attaschen, sodass der Weg möglicher Beeinflussung bzw.<br />
Übernahme nicht nachgezeichnet werden kann. 51<br />
F. Işık hat in einer Monographie die Felsheiligtümer der Urartäer auf<br />
ihre Beziehungen zu ähnlichen Anlagen bei Phrygern und Hethitern unter-<br />
47<br />
Alle drei von Kossian angeführten Namen finden sich in der Inschrift KARKAMIŠ A 7<br />
(Hawkins 2000, 129) § 9-11.<br />
48<br />
Diese Aussage leuchtet nicht ein, da im Hieroglyphenluwischen bis jetzt weder ein Zeichen<br />
mit dem Vokal e, noch eines mit o nachgewiesen werden konnte. Daher kann der Anlaut<br />
*Te- im Hieroglyphenluwischen nur mit ti- wiedergegeben werden; was den zweiten Teil<br />
des Gottesnamens angeht, so wird er zwar in hethitisch-hurritischer Keilschrift mit u-<br />
haltigen Zeichen geschrieben – was daran liegt, dass auch das Akkadische in der Schrift<br />
kein o unterschied –, die Lautung war Teššob; ob also durch die hieroglyphenluwische<br />
Schreibung ti-sa-pa- Teššob (mit *o>a wie im Hethitischen bei ererbtem *o) oder – etwa<br />
durch rückwirkende "Vokalharmonie" Teišeba ausgedrückt wurde – oder überhaupt eine<br />
Variante einer der beiden Formen – lässt sich auf Grund dieses einen Namens nicht entscheiden.<br />
49<br />
Novák 2004, besonders 302 mit weiterer Literatur.<br />
50<br />
Nieling 2004, 311f. Dass der urartäische Wettergott Teišeba mit dem (hurritischen) Teššob<br />
des "hethitischen" Pantheons in Verbindung steht, bezeugt m.E. noch keine Beeinflussung<br />
durch die späthethitischen Nachfolgestaaten, da ja das Urartäische mit dem Hurritischen<br />
des 2. Jahrtausends verwandt ist und daher auch in anderen Bereichen der Kultur hurritischurartäische<br />
Gemeinsamkeiten von vornherein bestanden haben können.<br />
51<br />
In der neueren Forschung wird der Ursprung im späthethitisch-luwischen Kulturbereich<br />
gesucht, vgl. Novák 2004, 302 mit Anm. 15.<br />
86