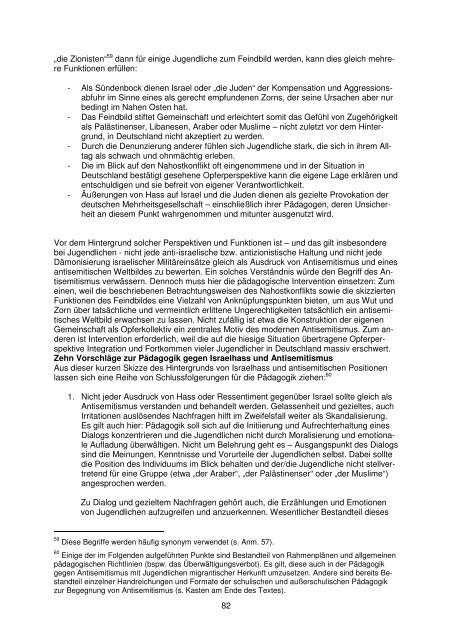Weblink...(PDF) - Dr. Stephan Rosiny
Weblink...(PDF) - Dr. Stephan Rosiny
Weblink...(PDF) - Dr. Stephan Rosiny
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„die Zionisten“ 59 dann für einige Jugendliche zum Feindbild werden, kann dies gleich mehrere<br />
Funktionen erfüllen:<br />
- Als Sündenbock dienen Israel oder „die Juden“ der Kompensation und Aggressionsabfuhr<br />
im Sinne eines als gerecht empfundenen Zorns, der seine Ursachen aber nur<br />
bedingt im Nahen Osten hat.<br />
- Das Feindbild stiftet Gemeinschaft und erleichtert somit das Gefühl von Zugehörigkeit<br />
als Palästinenser, Libanesen, Araber oder Muslime – nicht zuletzt vor dem Hintergrund,<br />
in Deutschland nicht akzeptiert zu werden.<br />
- Durch die Denunzierung anderer fühlen sich Jugendliche stark, die sich in ihrem Alltag<br />
als schwach und ohnmächtig erleben.<br />
- Die im Blick auf den Nahostkonflikt oft eingenommene und in der Situation in<br />
Deutschland bestätigt gesehene Opferperspektive kann die eigene Lage erklären und<br />
entschuldigen und sie befreit von eigener Verantwortlichkeit.<br />
- Äußerungen von Hass auf Israel und die Juden dienen als gezielte Provokation der<br />
deutschen Mehrheitsgesellschaft – einschließlich ihrer Pädagogen, deren Unsicherheit<br />
an diesem Punkt wahrgenommen und mitunter ausgenutzt wird.<br />
Vor dem Hintergrund solcher Perspektiven und Funktionen ist – und das gilt insbesondere<br />
bei Jugendlichen - nicht jede anti-israelische bzw. antizionistische Haltung und nicht jede<br />
Dämonisierung israelischer Militäreinsätze gleich als Ausdruck von Antisemitismus und eines<br />
antisemitischen Weltbildes zu bewerten. Ein solches Verständnis würde den Begriff des Antisemitismus<br />
verwässern. Dennoch muss hier die pädagogische Intervention einsetzen: Zum<br />
einen, weil die beschriebenen Betrachtungsweisen des Nahostkonflikts sowie die skizzierten<br />
Funktionen des Feindbildes eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten bieten, um aus Wut und<br />
Zorn über tatsächliche und vermeintlich erlittene Ungerechtigkeiten tatsächlich ein antisemitisches<br />
Weltbild erwachsen zu lassen. Nicht zufällig ist etwa die Konstruktion der eigenen<br />
Gemeinschaft als Opferkollektiv ein zentrales Motiv des modernen Antisemitismus. Zum anderen<br />
ist Intervention erforderlich, weil die auf die hiesige Situation übertragene Opferperspektive<br />
Integration und Fortkommen vieler Jugendlicher in Deutschland massiv erschwert.<br />
Zehn Vorschläge zur Pädagogik gegen Israelhass und Antisemitismus<br />
Aus dieser kurzen Skizze des Hintergrunds von Israelhass und antisemitischen Positionen<br />
lassen sich eine Reihe von Schlussfolgerungen für die Pädagogik ziehen: 60<br />
1. Nicht jeder Ausdruck von Hass oder Ressentiment gegenüber Israel sollte gleich als<br />
Antisemitismus verstanden und behandelt werden. Gelassenheit und gezieltes, auch<br />
Irritationen auslösendes Nachfragen hilft im Zweifelsfall weiter als Skandalisierung.<br />
Es gilt auch hier: Pädagogik soll sich auf die Initiierung und Aufrechterhaltung eines<br />
Dialogs konzentrieren und die Jugendlichen nicht durch Moralisierung und emotionale<br />
Aufladung überwältigen. Nicht um Belehrung geht es – Ausgangspunkt des Dialogs<br />
sind die Meinungen, Kenntnisse und Vorurteile der Jugendlichen selbst. Dabei sollte<br />
die Position des Individuums im Blick behalten und der/die Jugendliche nicht stellvertretend<br />
für eine Gruppe (etwa „der Araber“, „der Palästinenser“ oder „der Muslime“)<br />
angesprochen werden.<br />
Zu Dialog und gezieltem Nachfragen gehört auch, die Erzählungen und Emotionen<br />
von Jugendlichen aufzugreifen und anzuerkennen. Wesentlicher Bestandteil dieses<br />
59 Diese Begriffe werden häufig synonym verwendet (s. Anm. 57).<br />
60 Einige der im Folgenden aufgeführten Punkte sind Bestandteil von Rahmenplänen und allgemeinen<br />
pädagogischen Richtlinien (bspw. das Überwältigungsverbot). Es gilt, diese auch in der Pädagogik<br />
gegen Antisemitismus mit Jugendlichen migrantischer Herkunft umzusetzen. Andere sind bereits Bestandteil<br />
einzelner Handreichungen und Formate der schulischen und außerschulischen Pädagogik<br />
zur Begegnung von Antisemitismus (s. Kasten am Ende des Textes).<br />
82