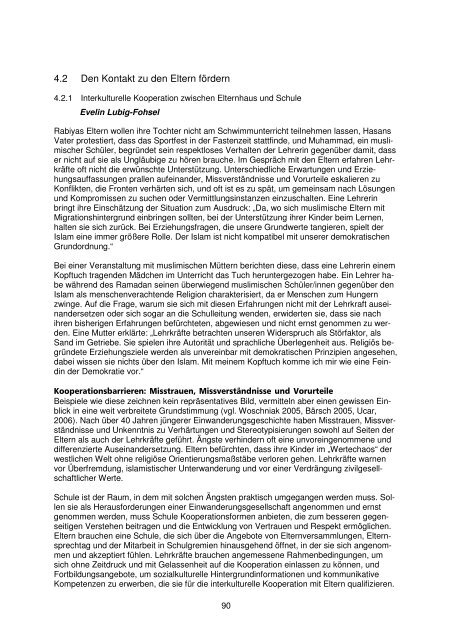Weblink...(PDF) - Dr. Stephan Rosiny
Weblink...(PDF) - Dr. Stephan Rosiny
Weblink...(PDF) - Dr. Stephan Rosiny
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.2 Den Kontakt zu den Eltern fördern<br />
4.2.1 Interkulturelle Kooperation zwischen Elternhaus und Schule<br />
Evelin Lubig-Fohsel<br />
Rabiyas Eltern wollen ihre Tochter nicht am Schwimmunterricht teilnehmen lassen, Hasans<br />
Vater protestiert, dass das Sportfest in der Fastenzeit stattfinde, und Muhammad, ein muslimischer<br />
Schüler, begründet sein respektloses Verhalten der Lehrerin gegenüber damit, dass<br />
er nicht auf sie als Ungläubige zu hören brauche. Im Gespräch mit den Eltern erfahren Lehrkräfte<br />
oft nicht die erwünschte Unterstützung. Unterschiedliche Erwartungen und Erziehungsauffassungen<br />
prallen aufeinander, Missverständnisse und Vorurteile eskalieren zu<br />
Konflikten, die Fronten verhärten sich, und oft ist es zu spät, um gemeinsam nach Lösungen<br />
und Kompromissen zu suchen oder Vermittlungsinstanzen einzuschalten. Eine Lehrerin<br />
bringt ihre Einschätzung der Situation zum Ausdruck: „Da, wo sich muslimische Eltern mit<br />
Migrationshintergrund einbringen sollten, bei der Unterstützung ihrer Kinder beim Lernen,<br />
halten sie sich zurück. Bei Erziehungsfragen, die unsere Grundwerte tangieren, spielt der<br />
Islam eine immer größere Rolle. Der Islam ist nicht kompatibel mit unserer demokratischen<br />
Grundordnung.“<br />
Bei einer Veranstaltung mit muslimischen Müttern berichten diese, dass eine Lehrerin einem<br />
Kopftuch tragenden Mädchen im Unterricht das Tuch heruntergezogen habe. Ein Lehrer habe<br />
während des Ramadan seinen überwiegend muslimischen Schüler/innen gegenüber den<br />
Islam als menschenverachtende Religion charakterisiert, da er Menschen zum Hungern<br />
zwinge. Auf die Frage, warum sie sich mit diesen Erfahrungen nicht mit der Lehrkraft auseinandersetzen<br />
oder sich sogar an die Schulleitung wenden, erwiderten sie, dass sie nach<br />
ihren bisherigen Erfahrungen befürchteten, abgewiesen und nicht ernst genommen zu werden.<br />
Eine Mutter erklärte: „Lehrkräfte betrachten unseren Widerspruch als Störfaktor, als<br />
Sand im Getriebe. Sie spielen ihre Autorität und sprachliche Überlegenheit aus. Religiös begründete<br />
Erziehungsziele werden als unvereinbar mit demokratischen Prinzipien angesehen,<br />
dabei wissen sie nichts über den Islam. Mit meinem Kopftuch komme ich mir wie eine Feindin<br />
der Demokratie vor.“<br />
Kooperationsbarrieren: Misstrauen, Missverständnisse und Vorurteile<br />
Beispiele wie diese zeichnen kein repräsentatives Bild, vermitteln aber einen gewissen Einblick<br />
in eine weit verbreitete Grundstimmung (vgl. Woschniak 2005, Bärsch 2005, Ucar,<br />
2006). Nach über 40 Jahren jüngerer Einwanderungsgeschichte haben Misstrauen, Missverständnisse<br />
und Unkenntnis zu Verhärtungen und Stereotypisierungen sowohl auf Seiten der<br />
Eltern als auch der Lehrkräfte geführt. Ängste verhindern oft eine unvoreingenommene und<br />
differenzierte Auseinandersetzung. Eltern befürchten, dass ihre Kinder im „Wertechaos“ der<br />
westlichen Welt ohne religiöse Orientierungsmaßstäbe verloren gehen. Lehrkräfte warnen<br />
vor Überfremdung, islamistischer Unterwanderung und vor einer Verdrängung zivilgesellschaftlicher<br />
Werte.<br />
Schule ist der Raum, in dem mit solchen Ängsten praktisch umgegangen werden muss. Sollen<br />
sie als Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft angenommen und ernst<br />
genommen werden, muss Schule Kooperationsformen anbieten, die zum besseren gegenseitigen<br />
Verstehen beitragen und die Entwicklung von Vertrauen und Respekt ermöglichen.<br />
Eltern brauchen eine Schule, die sich über die Angebote von Elternversammlungen, Elternsprechtag<br />
und der Mitarbeit in Schulgremien hinausgehend öffnet, in der sie sich angenommen<br />
und akzeptiert fühlen. Lehrkräfte brauchen angemessene Rahmenbedingungen, um<br />
sich ohne Zeitdruck und mit Gelassenheit auf die Kooperation einlassen zu können, und<br />
Fortbildungsangebote, um sozialkulturelle Hintergrundinformationen und kommunikative<br />
Kompetenzen zu erwerben, die sie für die interkulturelle Kooperation mit Eltern qualifizieren.<br />
90