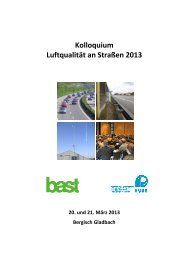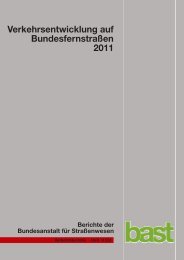Schmale zweibahnig vierstreifige Landstraßen (RQ 21)
Schmale zweibahnig vierstreifige Landstraßen (RQ 21)
Schmale zweibahnig vierstreifige Landstraßen (RQ 21)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
nenbedingten Verkehrsstörungen (Fahrzeitverluste<br />
durch Stau) sowie Störungen<br />
durch AkD. Mit Ausnahme der AkD fließen<br />
bei der Berechnung die Fahrleistung und<br />
der mittlere Abstand der NHB mit ein. Da<br />
bei einem geringeren NHB-Abstand die<br />
Störungshäufigkeit abnimmt, reduzieren<br />
sich die Kosten. Jedoch sind die höheren<br />
Investitionskosten durch die Mehranzahl<br />
der NHB zu berücksichtigen. In einem abschließenden<br />
Schritt sind die Nutzen gegenüber<br />
dem Kosten abzuwägen. Dabei<br />
obliegt es dem Straßenbaulastträger zu<br />
bestimmen, bei welchem Verhältnis der<br />
Bau eines <strong>RQ</strong> <strong>21</strong> gegenüber dem <strong>RQ</strong> 28<br />
einen Vorteil darstellt.<br />
- Eine weitere Form der Einsatzgrenzenbestimmung<br />
stellt die Erhebung aller Kosten<br />
dar, die auf Störungen des Verkehrsablaufes<br />
beruhen, welche bei einem Ausbau<br />
der Strecke mit einem Seitenstreifen<br />
vermieden werden könnten. Eine Ermittlung<br />
der Kosten kann anhand der Addition<br />
der Störfälle mit den jeweiligen zu erwartenden<br />
mittleren Kosten erfolgen. Auch in<br />
diesem Falle fließen die Fahrleistung, der<br />
mittlere NHB-Abstand und die Länge der<br />
Strecke in die Betrachtung ein. Überschreitet<br />
die Summe der Kosten einen bestimmten<br />
Grenzwert, ist der Ausbau der Strecke<br />
mit <strong>RQ</strong> 28 zu empfehlen.<br />
Alle Varianten beinhalten die Berücksichtigung der<br />
mittleren Anzahl der zu erwartenden Störungen im<br />
Verkehrsablauf. Diese basieren im Wesentlichen<br />
auf der fahrleistungsbezogenen mittleren Pannenrate.<br />
Damit verbunden ist eine kontinuierliche Zunahme<br />
der absoluten Störfälle mit steigender Streckenlänge.<br />
Eine besondere Charakteristik, die eine<br />
Begrenzung des <strong>RQ</strong> <strong>21</strong> auf 15 km rechtfertigt,<br />
konnte aus den Untersuchungen nicht bestimmt<br />
werden. Bei der Festlegung der Einsatzlänge sind<br />
die Kriterien und Ansprüche an die Straßenkategorien<br />
nach den RIN (FGSV, 2008C) und den allgemeinen<br />
Anforderungen der RAL (FGSV, 2008)<br />
einzubeziehen. Die bisher definierte Einsatzgrenze<br />
kann durch eine akzeptierte Anzahl von Störungen<br />
je Zeiteinheit, oder durch eine festgelegte Höhe<br />
vertretbarer Mehrkosten definiert werden. Die Untersuchungen<br />
zeigten weiterhin, dass die Einsatzgrenze<br />
in Abhängigkeit des mittleren NHB-<br />
Abstandes bei gleichen Randbedingungen variieren<br />
kann. Ein Neubau von <strong>RQ</strong> <strong>21</strong> ohne die Einrichtung<br />
von NHB wird nicht empfohlen.<br />
93<br />
8 Empfehlungen für Einsatz und<br />
Betrieb des <strong>RQ</strong> <strong>21</strong><br />
8.1 Allgemeine Einsatzgrenzen<br />
Laut Entwurf der RAL (FGSV, 2008) kommt der<br />
<strong>RQ</strong> <strong>21</strong> für kurze Abschnitte mit Verkehrsbelastungen<br />
zwischen 15.000 und 30.000 Kfz/24h in Betracht.<br />
Solche Verkehrsbelastungen treten häufig<br />
im Vorfeld mittlerer bis großer Agglomerationsräume<br />
auf. Dabei besitzen <strong>RQ</strong> <strong>21</strong>- ähnliche Abschnitte<br />
überwiegend die Funktion einer Radialstrecke<br />
mit Sammelfunktion für das Umland. Aus den dokumentierten<br />
Strecken geht hervor, dass Längen<br />
über 15 km im bestehenden Netz eher die Ausnahme<br />
darstellen. An einem Großteil der untersuchten<br />
Strecken die diese Charakteristik aufwiesen,<br />
waren Belastungsspitzen im Verkehrsaufkommen<br />
in den Früh- und Nachmittagsstunden<br />
festzustellen, was ein typisches Merkmal für den<br />
bezeichneten Straßentyp ist. In anderen Fällen<br />
stellten <strong>RQ</strong> <strong>21</strong>- ähnliche Abschnitte die Verbindung<br />
zwischen städtischen Zentren und dem naheliegenden<br />
übergeordneten Netz der BAB her und<br />
besitzen somit über einen kurzen Abschnitt eine<br />
hohe Verbindungsfunktion. Aus diesen Erkenntnissen<br />
können für den allgemeinen Einsatz des <strong>RQ</strong><br />
<strong>21</strong> folgende Empfehlungen abgegeben werden:<br />
- Der <strong>RQ</strong> <strong>21</strong> ist für kurze <strong>Landstraßen</strong>abschnitte<br />
mit hohen Verkehrsbelastungen<br />
geeignet. Dies gilt bei Situationen, bei denen<br />
eine Bündelung von <strong>Landstraßen</strong> mit<br />
einer gemeinsamen Verkehrsbelastung<br />
von über 15.000 Kfz/24h auftritt. Weiterhin<br />
ist der Einsatz für Strecken im Vorfeld von<br />
Agglomerationen vorgesehen, die eine<br />
Charakteristik als Radialstraße zur Bündelung<br />
der Verkehre des Umlandes besitzen<br />
oder welche die Funktion einer Verbindung<br />
zwischen der Agglomeration und dem nahegelegenen<br />
BAB-Netz aufweisen. Diese<br />
stellen in der Regel einen Übergang zu<br />
den in den RASt (FGSV, 2006C) aufgeführten<br />
typischen Entwurfssituationen der<br />
anbaufreien bzw. Verbindungsstraßen dar.<br />
- Der Einsatzbereich des <strong>RQ</strong> <strong>21</strong> soll eine<br />
Verkehrsstärke von 30.000 Kfz/24h nicht<br />
überschreiten. Bei höheren Verkehrsbelastungen<br />
sind auch kurze Streckenabschnitte<br />
nach den RAA (FGSV, 2008B) zu planen.<br />
Darüber hinaus wurde gezeigt, dass<br />
Verkehrsbelastungen von mehr als 30.000<br />
Kfz/24h zu einer erheblichen Zunahme von<br />
Stauereignissen aufgrund von Störungen<br />
des Verkehrsablaufs führen