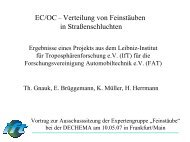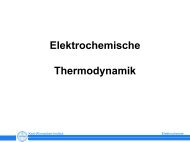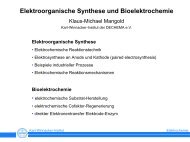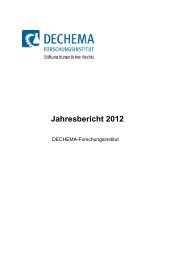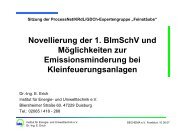Schlussbericht - Dechema Forschungsinstitut
Schlussbericht - Dechema Forschungsinstitut
Schlussbericht - Dechema Forschungsinstitut
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. Einleitung und Aufgabenstellung<br />
Seit der Einführung von Titanwerkstoffen, wie zum Beispiel der Legierung Ti 6Al 4V um<br />
1950, sind diese Werkstoffe aus den Bereichen der Luft- und Raumfahrt im Flugzeugzellen-<br />
und Triebwerksbau [1], der Energiegewinnung (in Kraftwerken und Ölbohrplattformen im<br />
Offshorebereich), dem Hochleistungsmotorenbau (Pleuelstangen, Verdichterräder und<br />
Abgasanlagen [2]), der chemischen Industrie als Material für Wärmetauscher oder Leitungen<br />
[3] und der Medizintechnik [3] nicht mehr wegzudenken. Die herausragenden Eigenschaften<br />
von Titanwerkstoffen, wie das ausgezeichnete Festigkeits-zu-Dichte-Verhältnis, die hohe<br />
Ermüdungsfestigkeit, Biokompatibilität und die sehr gute Korrosionsbeständigkeit führen zum<br />
Einsatz von Titanlegierungen auch in sicherheitskritischen Bereichen. Da Fügeverbindungen<br />
insbesondere bei mechanischer Wechselbelastung als Schwachstellen wirken können,<br />
werden Bauteile in sicherheitsrelevanten Anwendungen häufig durch spanende Bearbeitung<br />
aus einem geschmiedeten Rohling mit einem entsprechend hohen Schrottanteil hergestellt,<br />
der bei der Herstellung von Turbinenscheiben aus Titan bis zu 60% betragen kann [4].<br />
Aufgrund der aktuellen Diskussion im Hinblick auf eine Reduktion von CO2-Emissionen,<br />
um globalen Klimaveränderungen entgegen zu wirken, liegt eine neue Herausforderung im<br />
Maschinenbau auf der Gewichtsreduktion bewegter Teile, insbesondere im Fahrzeug- und<br />
Anlagenbau. Eine Möglichkeit zur Minimierung des Gewichts ohne größere Veränderungen<br />
in der Konstruktion läge in der Substitution von schwereren Stählen durch leichtere<br />
Titanlegierungen (unter anderem in Abgasanlagen oder im Motorenbereich) bei gleich<br />
bleibender Festigkeit. Der Verwendung von Titanwerkstoffen in der Großserienfertigung<br />
stehen jedoch insbesondere die hohen Rohstoffkosten, bedingt durch die aufwändige<br />
Erzaufbereitung, und die schlechte Bearbeitbarkeit entgegen [5].<br />
Andererseits sind Titanlegierungen in vielen Bereichen, in denen Aluminiumlegierungen<br />
an ihre Festigkeitsgrenze stoßen und deshalb substituiert werden müssen, überdimensioniert<br />
[6]. Entsprechend wären geringfügig geminderte mechanische Eigenschaften eines Titan-<br />
werkstoffs akzeptabel, wenn sich die Fertigungszeiten und -kosten, die mit der Titan-<br />
bearbeitung verbunden sind, deutlich reduzieren ließen. Denkbar wäre auch ein Einsatz von<br />
Titanwerkstoffen im Gusszustand. Selbst bei leicht verminderter Festigkeit und reduzierter<br />
Duktilität wären spanbare Titanwerkstoffe vielen Aluminiumlegierungen weiterhin überlegen<br />
und stellten damit in Hinblick auf eine gewichtsoptimierte Konstruktion eine Alternative dar,<br />
um Leichtbaukonzepte zu realisieren.<br />
Folgende Anforderungen lassen sich für einen Einsatz von Titanwerkstoffen in mittleren<br />
und größeren Serien formulieren:<br />
Reduktion der Rohstoffkosten, insbesondere durch den Einsatz möglichst günstiger<br />
Legierungselemente, da sich der Kroll-Prozess zur Titangewinnung zurzeit nicht<br />
ersetzen lässt (siehe auch Abschnitt 2.1.2) und daher das Basismaterial Titan in<br />
naher Zukunft verhältnismäßig teuer bleiben wird [7].<br />
Einsatz von Titanlegierungen im Gusszustand. Viele Komponenten aus<br />
Titanwerkstoffen lassen sich in Near-Net-Shape-Verfahren endkonturnah durch