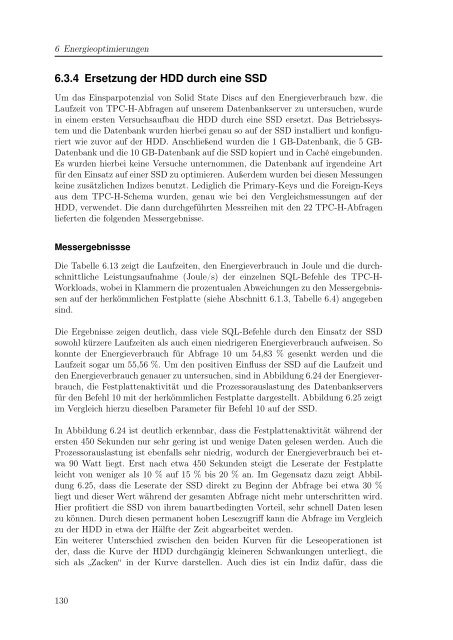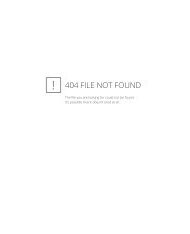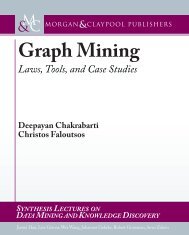Green-IT und Datenbanken - ODBMS
Green-IT und Datenbanken - ODBMS
Green-IT und Datenbanken - ODBMS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 Energieoptimierungen<br />
6.3.4 Ersetzung der HDD durch eine SSD<br />
Um das Einsparpotenzial von Solid State Discs auf den Energieverbrauch bzw. die<br />
Laufzeit von TPC-H-Abfragen auf unserem Datenbankserver zu untersuchen, wurde<br />
in einem ersten Versuchsaufbau die HDD durch eine SSD ersetzt. Das Betriebssystem<br />
<strong>und</strong> die Datenbank wurden hierbei genau so auf der SSD installiert <strong>und</strong> konfiguriert<br />
wie zuvor auf der HDD. Anschließend wurden die 1 GB-Datenbank, die 5 GB-<br />
Datenbank <strong>und</strong> die 10 GB-Datenbank auf die SSD kopiert <strong>und</strong> in Caché eingeb<strong>und</strong>en.<br />
Es wurden hierbei keine Versuche unternommen, die Datenbank auf irgendeine Art<br />
für den Einsatz auf einer SSD zu optimieren. Außerdem wurden bei diesen Messungen<br />
keine zusätzlichen Indizes benutzt. Lediglich die Primary-Keys <strong>und</strong> die Foreign-Keys<br />
aus dem TPC-H-Schema wurden, genau wie bei den Vergleichsmessungen auf der<br />
HDD, verwendet. Die dann durchgeführten Messreihen mit den 22 TPC-H-Abfragen<br />
lieferten die folgenden Messergebnisse.<br />
Messergebnissse<br />
Die Tabelle 6.13 zeigt die Laufzeiten, den Energieverbrauch in Joule <strong>und</strong> die durchschnittliche<br />
Leistungsaufnahme (Joule/s) der einzelnen SQL-Befehle des TPC-H-<br />
Workloads, wobei in Klammern die prozentualen Abweichungen zu den Messergebnissen<br />
auf der herkömmlichen Festplatte (siehe Abschnitt 6.1.3, Tabelle 6.4) angegeben<br />
sind.<br />
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass viele SQL-Befehle durch den Einsatz der SSD<br />
sowohl kürzere Laufzeiten als auch einen niedrigeren Energieverbrauch aufweisen. So<br />
konnte der Energieverbrauch für Abfrage 10 um 54,83 % gesenkt werden <strong>und</strong> die<br />
Laufzeit sogar um 55,56 %. Um den positiven Einfluss der SSD auf die Laufzeit <strong>und</strong><br />
den Energieverbrauch genauer zu untersuchen, sind in Abbildung 6.24 der Energieverbrauch,<br />
die Festplattenaktivität <strong>und</strong> die Prozessorauslastung des Datenbankservers<br />
für den Befehl 10 mit der herkömmlichen Festplatte dargestellt. Abbildung 6.25 zeigt<br />
im Vergleich hierzu dieselben Parameter für Befehl 10 auf der SSD.<br />
In Abbildung 6.24 ist deutlich erkennbar, dass die Festplattenaktivität während der<br />
ersten 450 Sek<strong>und</strong>en nur sehr gering ist <strong>und</strong> wenige Daten gelesen werden. Auch die<br />
Prozessorauslastung ist ebenfalls sehr niedrig, wodurch der Energieverbrauch bei etwa<br />
90 Watt liegt. Erst nach etwa 450 Sek<strong>und</strong>en steigt die Leserate der Festplatte<br />
leicht von weniger als 10 % auf 15 % bis 20 % an. Im Gegensatz dazu zeigt Abbildung<br />
6.25, dass die Leserate der SSD direkt zu Beginn der Abfrage bei etwa 30 %<br />
liegt <strong>und</strong> dieser Wert während der gesamten Abfrage nicht mehr unterschritten wird.<br />
Hier profitiert die SSD von ihrem bauartbedingten Vorteil, sehr schnell Daten lesen<br />
zu können. Durch diesen permanent hohen Lesezugriff kann die Abfrage im Vergleich<br />
zu der HDD in etwa der Hälfte der Zeit abgearbeitet werden.<br />
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Kurven für die Leseoperationen ist<br />
der, dass die Kurve der HDD durchgängig kleineren Schwankungen unterliegt, die<br />
sich als „Zacken“ in der Kurve darstellen. Auch dies ist ein Indiz dafür, dass die<br />
130