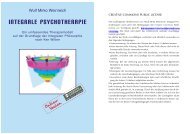Der integrale Ansatz nach Ken Wilber und seine ... - Michaelegli.ch
Der integrale Ansatz nach Ken Wilber und seine ... - Michaelegli.ch
Der integrale Ansatz nach Ken Wilber und seine ... - Michaelegli.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diplomarbeit Margit Geilenbrügge: <strong>Der</strong> <strong>integrale</strong> <strong>Ansatz</strong> <strong>na<strong>ch</strong></strong> <strong>Ken</strong> <strong>Wilber</strong> <strong>und</strong> <strong>seine</strong> Umsetzung... Seite 59<br />
6.1 Einige Begriffsklärungen<br />
6.1.1 Zur Definition von Organisations- <strong>und</strong> Personalentwicklung<br />
"Organisationsentwicklung" (OE) ist eine Konzeption der angewandten Sozialwissens<strong>ch</strong>aften<br />
mit "unmittelbarem Anwendungs<strong>ch</strong>arakter". (Sievers, 1977: 11) Hinter<br />
dem Begriff verbergen si<strong>ch</strong> eine Vielzahl von Methoden, Strategien <strong>und</strong> Zielvorstellungen.<br />
(Fren<strong>ch</strong>, Bell 1994; Sievers 1977; Glasl, de la Houssaye 1975; Becker, Langos<strong>ch</strong><br />
1984 u. a.) Die Gesells<strong>ch</strong>aft für Organisationsentwicklung e.V. bezieht si<strong>ch</strong> in<br />
ihrer Definition auf drei S<strong>ch</strong>werpunkte:<br />
1. Organisationsentwicklung ist ein langfristig angelegter Entwicklungs- <strong>und</strong> Veränderungsprozeß<br />
von Organisationen <strong>und</strong> der in ihr tätigen Mens<strong>ch</strong>en.<br />
2. <strong>Der</strong> Prozeß beruht auf Lernen aller Betroffenen dur<strong>ch</strong> direkte Mitwirkung <strong>und</strong><br />
praktis<strong>ch</strong>e Erfahrung.<br />
3. Das Ziel besteht in der glei<strong>ch</strong>zeitigen Verbesserung der Leistungsfähigkeit der<br />
Organisation (Effektivität) <strong>und</strong> der Qualität des Arbeitslebens (Humanität).<br />
(Gairing 1996: 12)<br />
Organisationsentwicklung (OE) ist dieser Definition <strong>na<strong>ch</strong></strong> ein langfristiger <strong>und</strong> planmäßiger<br />
Prozeß, der bei den Problemen einer Organisation ansetzt. OE bezieht alle<br />
beteiligten Organisationsmitglieder in den Prozeßzyklus von Datensammlung, Problemanalyse<br />
(Diagnose), Maßnahmenplanung (Intervention) <strong>und</strong> Erfolgskontrolle bei<br />
regelmäßigem Daten-Feedback ein. ("Betroffene werden zu Beteiligten.") (Fren<strong>ch</strong>,<br />
Bell 1994: 110-113) Entwicklung <strong>und</strong> Veränderung basieren auf dem Lernen aller<br />
Beteiligten. OE geht davon aus, daß mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>es Verhalten mit den organisationalen<br />
Strukturen <strong>und</strong> Abläufen in enger We<strong>ch</strong>selbeziehung steht <strong>und</strong> deshalb ni<strong>ch</strong>t isoliert<br />
betra<strong>ch</strong>tet werden kann. Deshalb gehören Organisations- <strong>und</strong> Personalentwicklung<br />
(OE/PE) zusammen, sie sind wie zwei Seite einer Münze. (Vergl. Uli<strong>ch</strong> 1992:<br />
110) Rolff verweist auf die Janus-Köpfigkeit des OE-Begriffs, die er auf <strong>seine</strong> unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>en<br />
Ursprünge - in der Betriebssoziologie <strong>und</strong> Managementlehre einerseits,<br />
in Lewins sozial-psy<strong>ch</strong>ologis<strong>ch</strong>en Fors<strong>ch</strong>ungen (Aktionsfors<strong>ch</strong>ung) andrerseits - zurückführt.<br />
Je <strong>na<strong>ch</strong></strong> Quelle, so Rolff, wird OE als "als effektivierende Sozialte<strong>ch</strong>nologie"<br />
oder "als pädagogis<strong>ch</strong>es <strong>und</strong> selbstreflexives Konzept" betra<strong>ch</strong>tet. (1995: 147f)<br />
Die Übertragung des <strong>Wilber</strong>s<strong>ch</strong>en <strong>Ansatz</strong>es in Berei<strong>ch</strong> OE/PE führt s<strong>ch</strong>einbar widersprü<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e<br />
Ansätze wie systemis<strong>ch</strong>e Konzepte der Prozeßoptimierungen, bei denen<br />
si<strong>ch</strong> konkrete Mens<strong>ch</strong>en in Kommunikationsprozesse <strong>und</strong> Interaktionsmuster auflösen,<br />
<strong>und</strong> Ansätze, die den konkreten Mens<strong>ch</strong>en, <strong>seine</strong> Bedürfnisse, <strong>seine</strong> Ziele in den<br />
Mittelpunkt stellen, zusammen. (s.u.) Diese <strong>und</strong> andere Besonderheiten des <strong>Wilber</strong>s<strong>ch</strong>en<br />
<strong>integrale</strong>n Modells ma<strong>ch</strong>en eine spezielle OE-Definition nötig, Deshalb sollen<br />
zunä<strong>ch</strong>st einige Gr<strong>und</strong>begriffe im Li<strong>ch</strong>te der Holon-Theorie neu formuliert. (s.u.)<br />
6.1.2 <strong>Der</strong> Begriff "Organisation" <strong>und</strong> "Organisationsmitglied"<br />
Na<strong>ch</strong> <strong>Wilber</strong>s Holon-Theorie stellt si<strong>ch</strong> eine Organisation als "soziales Holons plus<br />
Artefakte" dar, das "individuelle Holons als Mitglieder" hat. (siehe Abs<strong>ch</strong>nitt 4.1.2<br />
auf Seite 48) Zu diesen (mentalen) Artefakten zählen beispielsweise die Aufgaben,<br />
Regeln <strong>und</strong> Ziele einer Organisation. (s.u.) Die Organisationsmitglieder definieren<br />
si<strong>ch</strong> - wenn man sie als individuelle Holons betra<strong>ch</strong>tet - dur<strong>ch</strong> den S<strong>ch</strong>werpunkt ihres<br />
Bewußtseins. Sie stehen dur<strong>ch</strong> intersubjektiven Austaus<strong>ch</strong> miteinander in Verbindung<br />
<strong>und</strong> prägen so die Kultur der Organisation. Eine Organisation hat ein verteiltes,