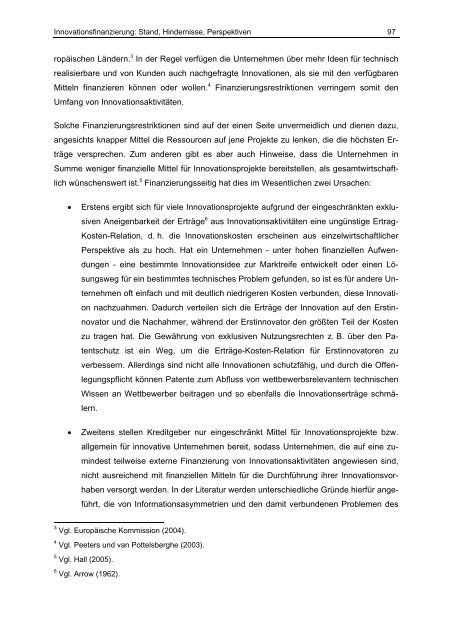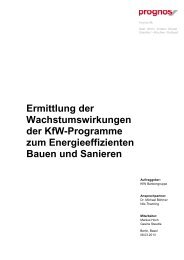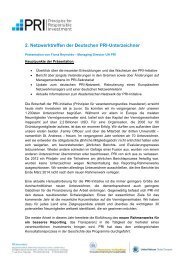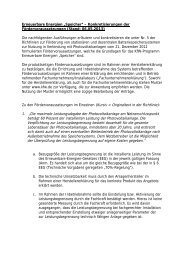Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Innovationsfinanzierung: Stand, Hindernisse, Perspektiven 97<br />
ropäischen Ländern. 3 In der Regel verfügen die Unternehmen über mehr Ideen für technisch<br />
realisierbare <strong>und</strong> von K<strong>und</strong>en auch nachgefragte Innovationen, als sie mit den verfügbaren<br />
Mitteln finanzieren können oder wollen. 4 Finanzierungsrestriktionen verringern somit den<br />
Umfang von Innovationsaktivitäten.<br />
Solche Finanzierungsrestriktionen sind auf der einen Seite unvermeidlich <strong>und</strong> dienen dazu,<br />
angesichts knapper Mittel die Ressourcen auf jene Projekte zu lenken, die die höchsten Erträge<br />
versprechen. Zum anderen gibt es aber auch Hinweise, dass die Unternehmen in<br />
Summe weniger finanzielle Mittel für Innovationsprojekte bereitstellen, als gesamtwirtschaftlich<br />
wünschenswert ist. 5 Finanzierungsseitig hat dies im Wesentlichen zwei Ursachen:<br />
• Erstens ergibt sich für viele Innovationsprojekte aufgr<strong>und</strong> der eingeschränkten exklusiven<br />
Aneigenbarkeit der Erträge 6 aus Innovationsaktivitäten eine ungünstige Ertrag-<br />
Kosten-Relation, d. h. die Innovationskosten erscheinen aus einzelwirtschaftlicher<br />
Perspektive als zu hoch. Hat ein Unternehmen - unter hohen finanziellen Aufwendungen<br />
- eine bestimmte Innovationsidee <strong>zur</strong> Marktreife entwickelt oder einen Lösungsweg<br />
für ein bestimmtes technisches Problem gef<strong>und</strong>en, so ist es für andere Unternehmen<br />
oft einfach <strong>und</strong> mit deutlich niedrigeren Kosten verb<strong>und</strong>en, diese Innovation<br />
nachzuahmen. Dadurch verteilen sich die Erträge der Innovation auf den Erstinnovator<br />
<strong>und</strong> die Nachahmer, während der Erstinnovator den größten Teil der Kosten<br />
zu tragen hat. Die Gewährung von exklusiven Nutzungsrechten z. B. über den Patentschutz<br />
ist ein Weg, um die Erträge-Kosten-Relation für Erstinnovatoren zu<br />
verbessern. Allerdings sind nicht alle Innovationen schutzfähig, <strong>und</strong> durch die Offenlegungspflicht<br />
können Patente zum Abfluss von wettbewerbsrelevantem technischen<br />
Wissen an Wettbewerber beitragen <strong>und</strong> so ebenfalls die Innovationserträge schmälern.<br />
• Zweitens stellen Kreditgeber nur eingeschränkt Mittel für Innovationsprojekte bzw.<br />
allgemein für innovative Unternehmen bereit, sodass Unternehmen, die auf eine zumindest<br />
teilweise externe Finanzierung von Innovationsaktivitäten angewiesen sind,<br />
nicht ausreichend mit finanziellen Mitteln für die Durchführung ihrer Innovationsvorhaben<br />
versorgt werden. In der Literatur werden unterschiedliche Gründe hierfür angeführt,<br />
die von Informationsasymmetrien <strong>und</strong> den damit verb<strong>und</strong>enen Problemen des<br />
3 Vgl. Europäische Kommission (2004).<br />
4 Vgl. Peeters <strong>und</strong> van Pottelsberghe (2003).<br />
5 Vgl. Hall (2005).<br />
6 Vgl. Arrow (1962).