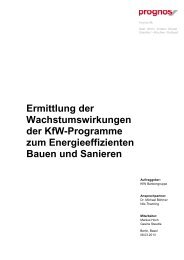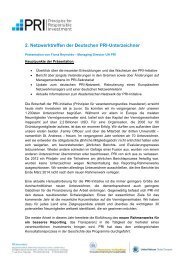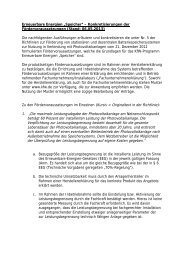Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Innovationsfinanzierung: Stand, Hindernisse, Perspektiven 115<br />
ten, dass der Verschuldungsgrad (Verhältnis von Fremdkapital <strong>zur</strong> Bilanzsumme) Patentaktivitäten<br />
negativ beeinflusst. Müller <strong>und</strong> Zimmermann (2005) weisen einen positiven Effekt der<br />
Eigenkapitalquote auf die FuE-Intensität nach.<br />
Anhand der Daten des IAB wurde in einem zweiten Schritt getestet, ob die Form der Innovationsfinanzierung<br />
einen Einfluss auf den Innovationserfolg ausübt. Innovationserfolg wurde<br />
dabei über den Umsatzanteil gemessen, der mit verschiedenen Kategorien von neuen Produkten<br />
im Jahr 2003 erzielt wurde. Die Schätzergebnisse zeigten jedoch durchweg keinen<br />
statistisch signifikanten Einfluss der Form der Innovationsfinanzierung. Dieses Ergebnis sollte<br />
jedoch nicht zu weitreichend interpretiert werden, als eine Querschnittsschätzung <strong>zur</strong> Untersuchung<br />
einer solchen Frage nur sehr eingeschränkt geeignet ist. Denn die aktuellen Innovationserfolge<br />
gehen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf die aktuell betriebenen Innovationsprojekte,<br />
sondern auf die früherer Perioden <strong>zur</strong>ück. Über die Finanzierung dieser früheren<br />
Innovationsaktivitäten liegen jedoch keine Informationen vor. Dass diese in gleicher<br />
Form finanziert wurden wie die aktuellen ist insofern nicht zwingend, als die Form der Innovationsfinanzierung<br />
offensichtlich stark von der Ertragslage der Betriebe abhängt, <strong>und</strong> diese<br />
sich kurzfristig merklich ändern kann.<br />
3.2 Innovationsfinanzierung <strong>und</strong> Unternehmensgewinne.<br />
Die große Bedeutung der Innenfinanzierung von Innovationen legt die Vermutung nahe, dass<br />
die Höhe der Unternehmensgewinne auf die Innovationsaktivitäten der Folgeperioden einen<br />
merklichen Einfluss ausübt. Theoretische Modelle lassen erwarten, dass Unternehmen bemüht<br />
sind, einen bestimmten Sockelbetrag an Innovationsaktivitäten zu halten den sie auch<br />
im Fall einer (vorübergehend) sehr ungünstigen Ertragssituation nicht unterschreiten, um hohe<br />
Anpassungskosten bei einer späteren erneuten Ausweitung zu vermeiden. Erhöht sich<br />
der Gewinn (oder Cashflow) über ein bestimmtes Maß, werden die zusätzlich verfügbaren<br />
Mittel in risikoträchtige, zusätzliche Projekte investiert, d. h. die Innovationsaufwendungen<br />
steigen. Ein Rückgang des Gewinns auf oder unter das langfristige Zielmaß würde zu einer<br />
entsprechenden Einschränkung dieser zusätzlichen Innovationsmittel führen.<br />
Um zu prüfen, ob ein solcher Mechanismus tatsächlich dominierend für das Innovationsverhalten<br />
der Unternehmen in Deutschland ist, wären Paneldaten zu Innovationsaufwendungen<br />
<strong>und</strong> Gewinnen über einen längeren Zeitraum notwendig, die jedoch nicht vorliegen. Allerdings<br />
kann auf Basis von Daten aus dem MIP der kurzfristige Einfluss der Umsatzrendite auf<br />
die Bereitschaft, Innovationsaktivitäten vorzunehmen, sowie auf die Höhe der für Innovationsprojekte<br />
bereitgestellten Mittel untersucht werden. Dabei zeigt sich für die Industrieunternehmen,<br />
dass von der Höhe der Umsatzrendite des Vorjahres kein Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit<br />
ausgeht, im Folgejahr Innovationsprojekte durchzuführen (s. Tabelle 3). Dieses