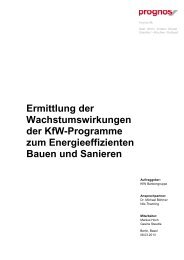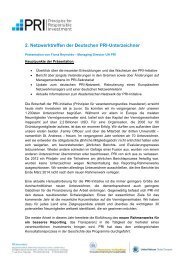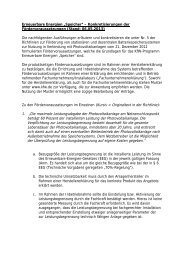Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Innovationsfinanzierung: Stand, Hindernisse, Perspektiven 107<br />
deutlich übersteigen. Im Fall einer reinen Innenfinanzierung von Innovationsaktivitäten ist<br />
daher anzunehmen, dass Unternehmen den Umfang ihrer Innovationsaktivitäten – vor allem<br />
längerfristig orientierte Komponenten wie FuE betreffend – niedriger halten, als <strong>zur</strong> Erreichung<br />
eines optimalen Outputs notwendig wäre, um hohe Anpassungskosten im Fall von<br />
Cashflow-Schwankungen zu vermeiden. 24<br />
2.4 Öffentliche Förderung von Innovationen.<br />
Öffentliche Förderungen für Innovationsprojekte in Form von Zuschüssen oder Kostenminderungen<br />
(z. B. von Steuern oder Abgaben) erhöhen den Cashflow der Unternehmen <strong>und</strong><br />
sind damit einer internen Finanzierungsquelle ähnlich. Der wesentliche Unterschied besteht<br />
allerdings in den compliance costs, die zum Erhalt einer öffentlichen Förderung entstehen.<br />
Diese sind abhängig von der Ausgestaltung des jeweiligen Programms <strong>und</strong> können direkte<br />
Kosten (Information über die Programmmerkmale, Erstellung eines Antrags, Suche <strong>und</strong> Einbindung<br />
von Kooperationspartnern, Einrichtung eines spezifischen Berichtswesens <strong>zur</strong> Erfüllung<br />
der Abrechnungs- <strong>und</strong> Controllinganforderungen) <strong>und</strong> Opportunitätskosten umfassen.<br />
Zu letzteren zählt z. B. die Wahl eines bestimmten Designs für ein Innovationsprojekt, um öffentliche<br />
Auflagen in Hinblick auf die eingesetzte Technologie, die Einbindung von Kooperationspartnern,<br />
die Laufzeit, den Projektumfang oder die Anwendung bestimmter Schutzmechanismen<br />
(z. B. Patente) zu erfüllen. Dies kann zu einem suboptimalen Projektdesign führen,<br />
<strong>und</strong> damit zu langfristig niedrigeren Erträgen im Fall einer erfolgreichen Projektumsetzung.<br />
Der Erhalt öffentlicher Fördermittel kann außerdem mit Veröffentlichungspflichten<br />
(z. B. Veröffentlichung des Projektantrags oder wichtiger Projektergebnisse) einhergehen<br />
<strong>und</strong> damit im Widerspruch zu den Strategien des Unternehmens zum Schutz seines geistigen<br />
Eigentums stehen. Schließlich ist die unter Umständen geringe Planbarkeit des Erhaltens<br />
von öffentlichen Fördermitteln ein Hemmnis für die Nutzung dieser Finanzierungsquelle.<br />
Hohe compliance costs, Veröffentlichungspflichten <strong>und</strong> die Unsicherheit über den Erhalt<br />
können dazu beitragen, dass Unternehmen auf staatliche Zuschüsse <strong>zur</strong> Finanzierung von<br />
Innovationsprojekten verzichten. Dabei sind jedoch deutliche Unterschiede in Abhängigkeit<br />
von der Ausgestaltung der Förderinstrumente zu erwarten. Zuschussprogramme auf Antragsbasis,<br />
die in Deutschland heute die vorherrschende Form der staatlichen Innovationsfinanzierung<br />
von Unternehmen darstellen, bieten einen hohen Beitrag zu den gesamten Kosten<br />
eines Innovationsprojektes (von bis zu 50 %) an, haben in der Regel jedoch vergleichsweise<br />
hohe compliance costs. Programme, die auf eine indirekte Förderung von Innovationskosten<br />
abzielen, indem sie eine Verringerung von Steuern oder Abgaben für innovativ tä-<br />
24 Vgl. Himmelberg <strong>und</strong> Petersen (1994).