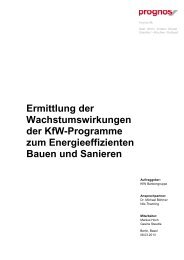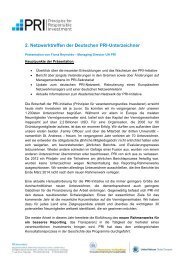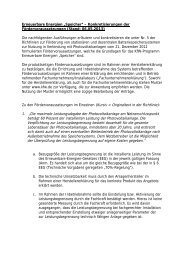Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
160 <strong>Mittelstands</strong>- <strong>und</strong> <strong>Strukturpolitik</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>37</strong><br />
keit <strong>und</strong> rechtlichen Sicherheit bieten Patente (<strong>und</strong> Marken 19 ) unter den verschiedenen Arten<br />
von immateriellen Vermögenswerten (siehe Kasten 2) vorerst die größten Möglichkeiten, als<br />
Kreditsicherheiten eingesetzt zu werden, da ihnen nicht nur eine formale Prüfung des Antrags<br />
vorausgeht, sondern auch eine Prüfung durch ein Patent- <strong>und</strong> Markenamt. Dies schafft<br />
Rechtssicherheit. Darüber hinaus lässt sich das Nutzungsrecht am Patent relativ unproblematisch<br />
auf den Kreditgeber übertragen. Der Kreditgeber muss jedoch darauf achten, dass<br />
auch mögliche Lizenzeinnahmen aus dem Patent bei der Besicherung einbezogen werden,<br />
da die Vergabe von Lizenzen rechtlich unabhängig vom Patent erfolgen kann.<br />
Kasten 4: Finanzielle Bewertungsverfahren für Patente.<br />
Finanzielle Bewertungsverfahren für immaterielle Vermögenswerte sind sowohl auf Gr<strong>und</strong> regulatorischer<br />
Anforderungen als auch aus Sicht der Kapitalgeber zentral für die Nutzung von IP für die<br />
Unternehmensfinanzierung. Für Patente sind in den letzten Jahren eine Reihe finanzieller Bewertungsverfahren<br />
entstanden, die in Zukunft gr<strong>und</strong>sätzlich auch für die Bewertung anderer immaterieller<br />
Vermögenswerte genutzt werden könnten. Relativ grob klassifiziert lassen sich vier Arten von<br />
Patentbewertungsverfahren unterscheiden:<br />
Beim Kostenansatz wird der Patentwert als Summe der FuE-Kosten geschätzt, die bis <strong>zur</strong> Patentanmeldung<br />
anfallen. Durch die Verwendung von aktuellen Preisen bei der Kostenermittlung wird der<br />
ständigen Alterung <strong>und</strong> dem damit einhergehenden Wertverlust der Patente Rechnung getragen. Die<br />
Annahme, dass die FuE-Ausgaben den Wert eines Patentes repräsentieren ist jedoch trotz eines<br />
statistischen Zusammenhanges beider Größen unrealistisch, da ansonsten auch teure Fehlentwicklungen<br />
sehr wertvoll wären. Der Kostenansatz eignet sich deshalb lediglich, um einen ersten Anhaltspunkt<br />
für den Patentwert zu erhalten.<br />
Der Einkommensansatz schätzt die aus einem Patent resultierenden zukünftigen Einkommensüberschüsse<br />
mittels der Kapitalwertmethode. Positiv ist, dass dadurch Restlaufzeit <strong>und</strong> die Verwertbarkeit<br />
eines Patentes in den geschätzten Patentwert eingehen. Problematisch ist jedoch neben dem<br />
erheblichen Prognoserisiko für die Vorhersage der aus dem Patent resultierenden Cashflows <strong>und</strong><br />
der Schwierigkeit, adäquate Diskontierungssätze zu wählen, dass eine asymmetrische Informationsverteilung<br />
zwischen Patentinhaber <strong>und</strong> Patentbewerter, die Bewertung erschwert. Denn oftmals<br />
verfügt nur der Patentinhaber über die relevanten Informationen <strong>zur</strong> Schätzung der Einkommensüberschüsse.<br />
Darüber hinaus ist es oft schwierig, die spezifischen Cashflows zu isolieren, die dem<br />
zu bewertenden Patent zu<strong>zur</strong>echnen sind, da die Patente meist in Kombination mit anderen Patenten<br />
oder technologischem Wissen in die Produktion von Gütern <strong>und</strong> Dienstleistungen eingeht. Der<br />
Einkommensansatz eignet sich deshalb umso besser, je stabiler <strong>und</strong> sicherer die Cahsflows aus<br />
dem zu bewertenden Patent prognostizierbar sind.<br />
Der Marktwertansatz vermeidet dieses Informationsproblem dadurch, dass er strukturell ähnliche<br />
patentgeschützte Erfindungen identifiziert, die bereits am Markt etabliert sind <strong>und</strong> somit historische<br />
Vergleichswerte liefert, anhand derer dann der Patentwert geschätzt wird. Beim so genannten f<strong>und</strong>amentalen<br />
Marktwertansatz geschieht diese Schätzung im Rahmen einer Recherche durch einen<br />
Experten. Dieses auch als Expertenansatz bezeichnete Verfahren ist dementsprechend teuer <strong>und</strong><br />
eignet sich deshalb nur für großvolumige Transaktionen wie Übernahmen patentintensiver Unternehmen.<br />
Beim quantitativen Marktwertansatz werden deshalb die Daten der historischen Patenttransaktionen<br />
in eine Datenbank eingestellt. Dann werden die erfassten Patente mit objektiv beobachtbaren<br />
erklärenden Variablen wie der Restlaufzeit oder der Anzahl überstandener juristischer<br />
19 Markenrechte haben gegenüber Patentrechten jedoch einen zentralen Nachteil als Kreditsicherheit,<br />
da der Markenwert erheblich von der Handlung des Kreditnehmers nach der Kreditbesicherung abhängt.<br />
Um das daraus resultierende Moral-Hazard-Problem zu lindern, müssen geeignete (Vertrags-)<br />
Maßnahmen ergriffen werden, welche die Anreize für den Sicherungsgeber, den Markenwert ex post<br />
zu reduzieren, verringern bzw. verhindern.