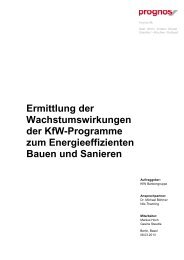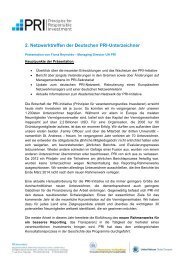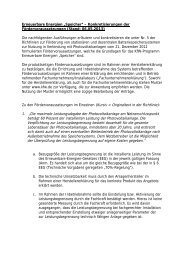Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Innovationsfinanzierung: Stand, Hindernisse, Perspektiven 127<br />
Eigenmitteln, sodass Unternehmen mit einer günstigen Ertragslage auf eine Fremdfinanzierung<br />
verzichten. Dieses Ergebnis stimmt mit den theoretisch abgeleiteten Erwartungen<br />
sowie mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen überein.<br />
• Staatliche Finanzierungsbeiträge werden zwar von knapp einem Viertel aller innovativ<br />
tätigen Unternehmen in Anspruch genommen. Ihr Beitrag <strong>zur</strong> Abdeckung der<br />
gesamten Innovationskosten der deutschen Wirtschaft ist jedoch vergleichsweise gering<br />
<strong>und</strong> dürfte insgesamt 5 % nicht überschreiten. Für die Gruppe der kleinen Unternehmen<br />
erreichen die staatlichen Finanzierungsbeiträge, zumindest was die FuE-<br />
Kosten betrifft, 10 %. Entsprechend der Ausgestaltung der Programme können die<br />
staatlichen Zuschüsse bis zu 50 % der FuE-Kosten eines geförderten Unternehmens<br />
in einer bestimmten Periode erreichen.<br />
• Wagniskapital hat für die Finanzierung von Innovationen in Deutschland eine geringe<br />
Rolle. Aktuell werden nicht mehr als 1 % der gesamten Innovationsaufwendungen<br />
der deutschen Wirtschaft über Wagniskapitalinvestitionen finanziert. Höhere Finanzierungsbeiträge<br />
von maximal bis zu 5 % wurden nur im Boomjahr des deutschen<br />
Wagniskapitalmarkts (2000) erreicht. Der Anteil der innovativ tätigen Unternehmen,<br />
die Wagniskapitalinvestitionen erhalten, überschreitet in keinem Jahr die 2 %-Marke<br />
deutlich. Gleichwohl ist dieser Anteil in bestimmten Teilgruppen, wie z. B. jungen <strong>und</strong><br />
sehr forschungsintensiven Unternehmen, deutlich höher. Dies gilt allen voran für die<br />
Biotechnologiebranche. Deren FuE-Aufwendungen sind zu einem wesentlichen Teil<br />
über Wagniskapital finanziert.<br />
Eine Analyse des Zusammenhangs zwischen Innovationen <strong>und</strong> Unternehmensgewinn<br />
deutet - bei allen notwendigen Vorbehalten aufgr<strong>und</strong> des sehr kurzen Beobachtungszeitraums<br />
<strong>und</strong> der Außerachtlassung von dynamischen Effekten - darauf hin, dass sich Innovationsaktivitäten<br />
<strong>und</strong> Innenfinanzierungsmöglichkeiten gegenseitig verstärken: Innovatoren erzielen<br />
höhere Renditen, <strong>und</strong> höhere Renditen wirken sich positiv auf den Umfang der für Innovationsprojekte<br />
eingesetzten Mittel aus. Für den aktuellen Beobachtungszeitraum (Rendite<br />
2003, Innovationsintensität 2004) zeigt sich der zuletzt genannte Einfluss jedoch nur für sehr<br />
hohe Renditen. Ein positiver Einfluss der Umsatzrendite auf die Bereitschaft, überhaupt innovativ<br />
tätig zu werden oder zu bleiben, konnte dagegen nicht festgestellt werden. Hierfür<br />
mag aber auch die spezifische konjunkturelle Situation eine Rolle spielen.<br />
Die positive Wechselwirkung zwischen erfolgreichen Innovationen <strong>und</strong> der Höhe der Rendite,<br />
bedeuten, dass es für erfolgreiche Innovatoren tendenziell einfacher ist, ihre künftigen Innovationsprojekte<br />
aus eigener Kraft zu finanzieren, während nicht innovationsaktive sowie<br />
weniger erfolgreich innovierende Unternehmen sich dagegen tendenziell einer ungünstigeren