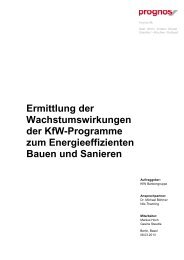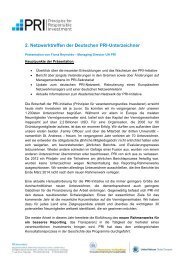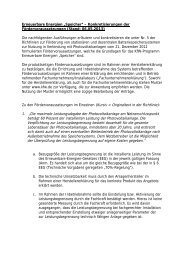Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik Nr. 37 - KfW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
128 <strong>Mittelstands</strong>- <strong>und</strong> <strong>Strukturpolitik</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>37</strong><br />
Ertragslage gegenüber sehen, die auch die Finanzierung von weiteren Innovationen erschwert.<br />
Dieser Zusammenhang schafft zum einen deutliche Anreize für Unternehmen, in<br />
Innovationen zu investieren. Allerdings bedeutet er auch, dass viele Unternehmen trotz dieser<br />
Anreize aufgr<strong>und</strong> fehlender Mittel keine Möglichkeit sehen, in das Innovationsgeschäft<br />
einzusteigen bzw. ihre Innovationsaktivitäten auf einen Umfang zu erhöhen, der für erfolgreiche<br />
Innovationen notwendig ist. Dieses Insider-Outsider-Problem führt tendenziell zu einer<br />
Zweiteilung zwischen erfolgreichen Innovatoren <strong>und</strong> nicht innovierenden Unternehmen <strong>und</strong><br />
droht den Innovationswettbewerb sowie die Nutzung der in den nicht innovierenden Unternehmen<br />
vorhandenen Innovationspotenziale schwächen.<br />
4. Finanzierung als Innovationshemmnis.<br />
Die Finanzierung von Innovationsprojekten zählt zweifelsfrei zu einer der großen Herausforderungen<br />
im Innovationsmanagement jedes Unternehmens. Wie bei jedem Investitionsprojekt<br />
gilt es auch bei Innovationen, eine Abwägung zwischen den voraussichtlichen Kosten<br />
<strong>und</strong> den zu erwartenden Erträgen vorzunehmen. Im Gegensatz zu Sachkapitalinvestitionen<br />
bestehen jedoch bei beiden Größen deutlich höhere Risiken, bis hin zu einer Situation der<br />
Ungewissheit. Dies bedeutet, dass aufgr<strong>und</strong> des Fehlens von Erfahrungswissen viele Innovationsprojekte<br />
für das Unternehmen Neuland darstellen <strong>und</strong> keine Angaben über die Wahrscheinlichkeit<br />
gemacht werden können, ob ein Projekt technologisch umsetzbar ist, welche<br />
Kosten letztlich entstehen werden, ob das daraus resultierende neue Marktangebot von den<br />
K<strong>und</strong>en auch angenommen wird, welcher Preis durchsetzbar ist, wie die Wettbewerber reagieren<br />
bzw. ob eine Prozessinnovation die erwarteten Effekte zeigt. Von daher verw<strong>und</strong>ert<br />
es auch nicht, dass Finanzierungsfragen immer wieder <strong>zur</strong> Behinderung von Innovationsaktivitäten<br />
führen, sei es, dass die Kosten von Innovationsprojekten als zu hoch eingeschätzt<br />
werden, sei es wegen eines als zu hoch wahrgenommenen Risikos, sei es aufgr<strong>und</strong> des<br />
Fehlens von konkreten Finanzierungsquellen <strong>zur</strong> Umsetzung von Innovationsideen.<br />
4.1 Verbreitung des Hemmnisses „Mangel an Finanzierungsquellen“.<br />
Zu hohe Innovationskosten, ein zu hohes wirtschaftliches Risiko <strong>und</strong> ein Mangel an Finanzierungsquellen<br />
stellen seit zehn Jahren die Spitze der Innovationshemmnisse in Industrie <strong>und</strong><br />
wissensintensiven Dienstleistungen Deutschlands (s. Tabelle 6) dar. In der Industrie stehen<br />
die zu hohen Innovationskosten in jeder betrachteten Periode an erster Stelle der Innovationshemmnisse<br />
<strong>und</strong> in den wissensintensiven Dienstleistungen ist teilweise auch das zu hohe<br />
wirtschaftliche Risiko das wichtigste Innovationshemmnis. Beide Hemmnisse hängen mit<br />
Finanzierungsfragen zusammen, liegen allerdings auch in der Natur der Innovationstätigkeit<br />
begründet. Hohe Kosten im Vergleich zu den stets ungewissen Erträgen sind Kennzeichen