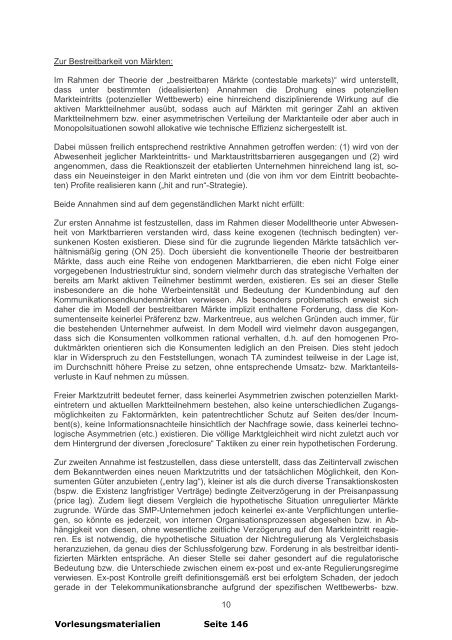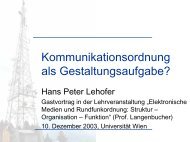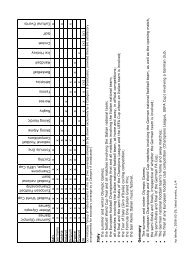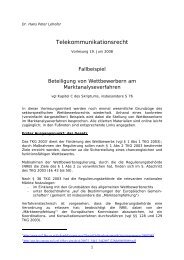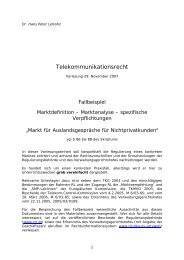Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zur Bestreitbarkeit von Märkten:<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Theorie <strong>der</strong> „bestreitbaren Märkte (contestable markets)“ wird unterstellt,<br />
dass unter bestimmten (idealisierten) Annahmen die Drohung eines potenziellen<br />
Markteintritts (potenzieller Wettbewerb) eine hinreichend disziplinierende Wirkung auf die<br />
aktiven Marktteilnehmer ausübt, sodass auch auf Märkten mit geringer Zahl an aktiven<br />
Marktteilnehmern bzw. einer asymmetrischen Verteilung <strong>der</strong> Marktanteile o<strong>der</strong> aber auch in<br />
Monopolsituationen sowohl allokative wie technische Effizienz sichergestellt ist.<br />
Dabei müssen freilich entsprechend restriktive Annahmen getroffen werden: (1) wird von <strong>der</strong><br />
Abwesenheit jeglicher Markteintritts- und Marktaustrittsbarrieren ausgegangen und (2) wird<br />
angenommen, dass die Reaktionszeit <strong>der</strong> etablierten Unternehmen hinreichend lang ist, sodass<br />
ein Neueinsteiger in den Markt eintreten und (die von ihm vor dem Eintritt beobachteten)<br />
Profite realisieren kann („hit and run“-Strategie).<br />
Beide Annahmen sind auf dem gegenständlichen Markt nicht erfüllt:<br />
Zur ersten Annahme ist festzustellen, dass im Rahmen dieser Modelltheorie unter Abwesenheit<br />
von Marktbarrieren verstanden wird, dass keine exogenen (technisch bedingten) versunkenen<br />
Kosten existieren. Diese sind <strong>für</strong> die zugrunde liegenden Märkte tatsächlich verhältnismäßig<br />
gering (ON 25). Doch übersieht die konventionelle Theorie <strong>der</strong> bestreitbaren<br />
Märkte, dass auch eine Reihe von endogenen Marktbarrieren, die eben nicht Folge einer<br />
vorgegebenen Industriestruktur sind, son<strong>der</strong>n vielmehr durch das strategische Verhalten <strong>der</strong><br />
bereits am Markt aktiven Teilnehmer bestimmt werden, existieren. Es sei an dieser Stelle<br />
insbeson<strong>der</strong>e an die hohe Werbeintensität und Bedeutung <strong>der</strong> Kundenbindung auf den<br />
Kommunikationsendkundenmärkten verwiesen. Als beson<strong>der</strong>s problematisch erweist sich<br />
daher die im Modell <strong>der</strong> bestreitbaren Märkte implizit enthaltene For<strong>der</strong>ung, dass die Konsumentenseite<br />
keinerlei Präferenz bzw. Markentreue, aus welchen Gründen auch immer, <strong>für</strong><br />
die bestehenden Unternehmer aufweist. In dem Modell wird vielmehr davon ausgegangen,<br />
dass sich die Konsumenten vollkommen rational verhalten, d.h. auf den homogenen Produktmärkten<br />
orientieren sich die Konsumenten lediglich an den Preisen. Dies steht jedoch<br />
klar in Wi<strong>der</strong>spruch zu den Feststellungen, wonach TA zumindest teilweise in <strong>der</strong> Lage ist,<br />
im Durchschnitt höhere Preise zu setzen, ohne entsprechende Umsatz- bzw. Marktanteilsverluste<br />
in Kauf nehmen zu müssen.<br />
Freier Marktzutritt bedeutet ferner, dass keinerlei Asymmetrien zwischen potenziellen Markteintretern<br />
und aktuellen Marktteilnehmern bestehen, also keine unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten<br />
zu Faktormärkten, kein patentrechtlicher Schutz auf Seiten des/<strong>der</strong> Incumbent(s),<br />
keine Informationsnachteile hinsichtlich <strong>der</strong> Nachfrage sowie, dass keinerlei technologische<br />
Asymmetrien (etc.) existieren. Die völlige Marktgleichheit wird nicht zuletzt auch vor<br />
dem Hintergrund <strong>der</strong> diversen „foreclosure“ Taktiken zu einer rein hypothetischen For<strong>der</strong>ung.<br />
Zur zweiten Annahme ist festzustellen, dass diese unterstellt, dass das Zeitintervall zwischen<br />
dem Bekanntwerden eines neuen Marktzutritts und <strong>der</strong> tatsächlichen Möglichkeit, den Konsumenten<br />
Güter anzubieten („entry lag“), kleiner ist als die durch diverse Transaktionskosten<br />
(bspw. die Existenz langfristiger Verträge) bedingte Zeitverzögerung in <strong>der</strong> Preisanpassung<br />
(price lag). Zudem liegt diesem Vergleich die hypothetische Situation unregulierter Märkte<br />
zugrunde. Würde das SMP-Unternehmen jedoch keinerlei ex-ante Verpflichtungen unterliegen,<br />
so könnte es je<strong>der</strong>zeit, von internen Organisationsprozessen abgesehen bzw. in Abhängigkeit<br />
von diesen, ohne wesentliche zeitliche Verzögerung auf den Markteintritt reagieren.<br />
Es ist notwendig, die hypothetische Situation <strong>der</strong> Nichtregulierung als Vergleichsbasis<br />
heranzuziehen, da genau dies <strong>der</strong> Schlussfolgerung bzw. For<strong>der</strong>ung in als bestreitbar identifizierten<br />
Märkten entspräche. An dieser Stelle sei daher geson<strong>der</strong>t auf die regulatorische<br />
Bedeutung bzw. die Unterschiede zwischen einem ex-post und ex-ante Regulierungsregime<br />
verwiesen. Ex-post Kontrolle greift definitionsgemäß erst bei erfolgtem Schaden, <strong>der</strong> jedoch<br />
gerade in <strong>der</strong> Telekommunikationsbranche aufgrund <strong>der</strong> spezifischen Wettbewerbs- bzw.<br />
10<br />
<strong>Vorlesung</strong>smaterialien Seite 146