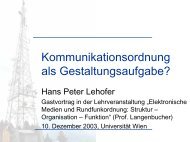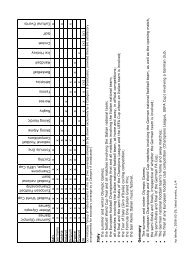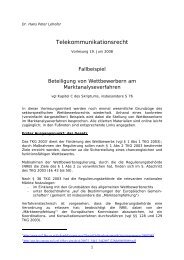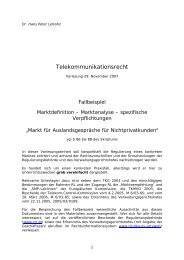Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Potential an Wohlfahrtszugewinnen, die mit <strong>der</strong> Produktbündelung einhergehen, die damit<br />
verbundene Problematik <strong>der</strong> Marktmachtübertragung gegenübergestellt werden. Nicht-<br />
Privatkunden fragen oftmals eine Vielfalt von unterschiedlichen Telekommunikationsleistungen<br />
nach, wobei die Auswahl des Betreibers oftmals im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Abwicklung<br />
von Projektgeschäften erfolgt.<br />
Wie insbeson<strong>der</strong>e die nach Anschlussarten differenzierten Tarifstrukturen zeigen, offeriert<br />
Telekom Austria auch bei Auslandsgesprächen von Nichtprivatkunden eine höhere Tarifvielfalt.<br />
Auf Grund <strong>der</strong> je nach Tarifmodell unterschiedlichen Abrechnungsformen, z.B. die Art<br />
<strong>der</strong> Taktung (vgl. ON 25, Kapitel 5.5.2.), die diversen Vergünstigungen einzelner Tarifoptionen<br />
(etwa einheitliche Tarife zu ausländischen Fest- und Mobilnetzen) o<strong>der</strong> sonstiger Tarifspezifika<br />
ergibt sich nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit <strong>der</strong> unterschiedlichen Tarife.<br />
So können etwa bei dem <strong>für</strong> Geschäftskunden konzipierten Tarifmodell „TikTak Business“<br />
von TA individuell 3 internationale “Wunschdestinationen” mit entsprechend niedrigeren Tarifen<br />
gewählt werden.<br />
Das Problem <strong>der</strong> Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Tarifpaketen kann umgangen werden,<br />
indem man eine „Preisgröße“ konstruiert und (die jeweils relevanten) Umsätze durch die<br />
zugehörigen Sprachminuten dividiert und so einen „impliziten Preisbasket“ errechnet. Der<br />
Vergleich <strong>der</strong> Preise auf dem gegenständlichen Markt <strong>für</strong> Nichtprivatkunden durch die Gutachter<br />
erfolgte sohin auf Basis <strong>der</strong> Berechnung von „impliziten Preisen“, wobei es auf Grund<br />
<strong>der</strong> nicht mehr isolierten Darstellung <strong>der</strong> Preis- und Mengeneffekte notwendig ist, Korrekturfaktoren<br />
in die Berechnung <strong>der</strong> impliziten Preise miteinzubeziehen.<br />
Im Gegensatz zur Vergleichssituation auf den Markt <strong>für</strong> Auslandsgespräche von Privatkunden<br />
kann Telekom Austria, den obigen Ausführungen zur Berechnung impliziter Preise folgend,<br />
auf dem gegenständlichen Markt <strong>für</strong> Nichtprivatkunden bei stabil bleibenden Marktanteilen<br />
zum Teil deutlich höhere Preisniveaus aufrecht erhalten. Diese höheren Preisaufschläge<br />
führen im Vergleich zu <strong>der</strong> Marktsituation bei Auslandsgesprächen von Privatkunden<br />
jedoch nicht zu einem niedrigeren Marktanteil (vgl. ON 25, Kapitel 5.1.3).<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> weiteren wettbewerblichen Entwicklung können nur schwer preisliche Än<strong>der</strong>ungstendenzen<br />
ausgemacht werden, auch nicht hinsichtlich <strong>der</strong> Richtung allfälliger Preisanpassungen.<br />
Am ehesten wird man auch hier – analog zu den Marktanteilsverläufen – mittelfristig<br />
von einer konstanten Fortentwicklung ausgehen müssen. Im Gegensatz zu den Märkten<br />
<strong>für</strong> Inlandsgespräche besteht bei gegenständlichem Markt allerdings nach wie vor ein<br />
Potential an Preisunterbietungen <strong>für</strong> alternative Anbieter, wenn auch in etwas geringerem<br />
Ausmaß als bei Privatkunden.<br />
2.1.5. Performance<br />
Die Wahl geeigneter Performance-Maße ist ein wichtiger Schritt, um Marktmacht von Unternehmen<br />
zu beschreiben. Exzessiv hohe Werte <strong>für</strong> ein Performance-Maß eines Unternehmens,<br />
das heißt eine hohe erreichte Rentabilität des eingesetzten Kapitals im Vergleich zu<br />
Konkurrenten, lassen gegebenenfalls den Schluss auf eine starke Marktposition zu.<br />
Unter einer Rentabilitätsgröße wird allgemein das Verhältnis einer Erfolgsgröße zu einer<br />
Einsatzgröße verstanden. Die erreichte Rentabilität errechnet sich aus dem Verhältnis des<br />
erreichten Gewinns im Verhältnis zu den da<strong>für</strong> notwendigerweise eingesetzten Mitteln (Eingangsgröße).<br />
Je nachdem, welche Eingangskomponenten <strong>für</strong> obigen Zusammenhang gewählt werden,<br />
lassen sich diverse traditionelle Rentabilitäts- bzw. Erfolgsgrößen ableiten:<br />
Umsatzrentabilität (ROS)<br />
12<br />
<strong>Vorlesung</strong>smaterialien Seite 63