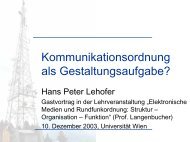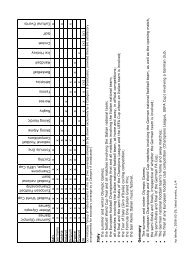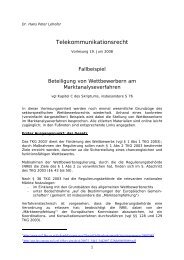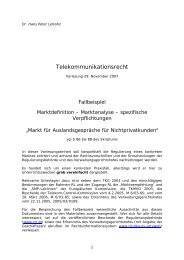Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
lichkeit, von den Erfolgen <strong>der</strong> Liberalisierung auch indirekt – ohne selbst zu wechseln – zu<br />
profitieren. Damit diese Barrieren überwunden werden, muss von den alternativen Betreibern<br />
ein entsprechend aggressiver Einsatz unternehmerischer Aktionsparameter, insbeson<strong>der</strong>e<br />
im Bereich des Preis-, Werbe-, Marketing- und Distributionswettbewerbs forciert werden.<br />
Derartige Kosten könnten typischerweise im Falle eines Marktaustritts nicht mehr wie<strong>der</strong>gewonnen<br />
werden. Umgekehrt können alternative Betreiber in <strong>der</strong> gegenwärtigen Marktsituation<br />
kaum eine enge Kundenbindung aufbauen, insbeson<strong>der</strong>e <strong>für</strong> Call by Call Kunden wird<br />
diese nur sehr gering sein.<br />
Die festgestellte Stagnation bzw. <strong>der</strong> leichte Rückgang von Marktein- bzw. austritten lässt<br />
sich jeweils anhand <strong>der</strong> aktuellen Marktphase, mit entsprechend hohem Verdrängungswettbewerb,<br />
enger werdenden Gewinnmargen und den einhergehenden Konsolidierungsprozessen,<br />
wie eben dem jüngst erfolgten Zusammenschluss von Tele2 und UTA, erklären. Ist eine<br />
hohe Zahl an Marktzutritten am Beginn <strong>der</strong> Liberalisierung geradezu typisch, so können sie<br />
in späteren Marktphasen nur mehr mit geringeren Erfolgschancen durchgeführt werden.<br />
Schließlich begründet <strong>der</strong> bereits beobachtbare Trend zum „One-Stop-Shopping“ eine Notwendigkeit,<br />
als Komplettanbieter auf den jeweiligen Märkten agieren zu können. Diejenigen,<br />
denen dies möglich ist, können auch mit entsprechenden Verbundvorteilen in <strong>der</strong> Produktion<br />
rechnen. Umgekehrt würde eine <strong>der</strong>artige Notwendigkeit, als Komplettanbieter agieren zu<br />
müssen, <strong>für</strong> potentielle Newcomer einen erhöhten Kapitalbedarf begründen und so die<br />
Wahrscheinlichkeit des Markteintritts reduzieren.<br />
Die Wettbewerbsproblematik liegt daher primär in <strong>der</strong> Beständigkeit <strong>der</strong> Marktbarrieren. Als<br />
Beleg da<strong>für</strong> zeichnete sich in letzter Zeit eine Phase <strong>der</strong> Konsolidierung <strong>der</strong> Marktanteile <strong>der</strong><br />
Telekom Austria auf hohem Niveau (rund 60%) ab. Alternative Anbieter können die Nachfrager<br />
nur mit spürbaren Preisvorteilen zum Überwinden <strong>der</strong> existierenden Wechselbarrieren<br />
bewegen. Diese sind im gegenständlichen Markt deshalb vergleichsweise hoch, als Zuverlässigkeitsanfor<strong>der</strong>ungen<br />
und sonstige Qualitätsmerkmale hier beson<strong>der</strong>s wichtig sind. Sowohl<br />
tatsächliche Qualitätsvorsprünge auf Seiten <strong>der</strong> Telekom Austria aufgrund höherwertiger<br />
und vor allem eigener Infrastruktur o<strong>der</strong> <strong>der</strong> historisch gewachsenen internationalen<br />
(Partner-)Netzstruktur als auch subjektiv von Nachfragern empfundene Vorteile erklären solche<br />
Wechselbarrieren. Letztere dürften vor allem im Zuge von Unternehmenskonkursen alternativer<br />
Anbieter noch verstärkt werden, da diesfalls mit negativen Reputationswirkungen<br />
auf die Gesamtheit aller alternativen Betreiber zu rechnen ist.<br />
Zur Bestreitbarkeit von Märkten:<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Theorie <strong>der</strong> „bestreitbaren Märkte (contestable markets)“ wird unterstellt,<br />
dass unter bestimmten (idealisierten) Annahmen die Drohung eines potenziellen<br />
Markteintritts (potenzieller Wettbewerb) eine hinreichend disziplinierende Wirkung auf die<br />
aktiven Marktteilnehmer ausübt, sodass auch auf Märkten mit geringer Zahl an aktiven<br />
Marktteilnehmern bzw. einer asymmetrischen Verteilung <strong>der</strong> Marktanteile o<strong>der</strong> aber auch in<br />
Monopolsituationen sowohl allokative wie technische Effizienz sichergestellt ist.<br />
Dabei müssen freilich entsprechend restriktive Annahmen getroffen werden: (1) wird von <strong>der</strong><br />
Abwesenheit jeglicher Markteintritts- und Marktaustrittsbarrieren ausgegangen und (2) wird<br />
angenommen, dass die Reaktionszeit <strong>der</strong> etablierten Unternehmen hinreichend lang ist, sodass<br />
ein Neueinsteiger in den Markt eintreten und (die von ihm vor dem Eintritt beobachteten)<br />
Profite realisieren kann („hit and run“-Strategie).<br />
Beide Annahmen sind auf dem gegenständlichen Markt nicht erfüllt:<br />
Zur ersten Annahme ist festzustellen, dass im Rahmen dieser Modelltheorie unter Abwesenheit<br />
von Marktbarrieren verstanden wird, dass keine exogenen (technisch bedingten) versunkenen<br />
Kosten existieren. Diese sind <strong>für</strong> die zugrunde liegenden Märkte tatsächlich ver-<br />
<strong>Vorlesung</strong>smaterialien Seite 60<br />
9