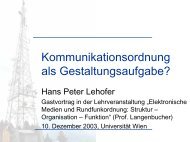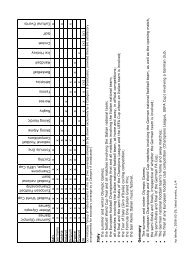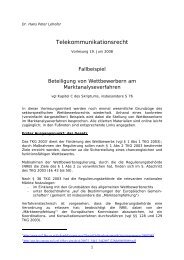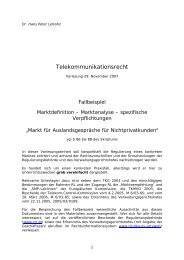Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Fallbeispiel für WU-Vorlesung - Rechtsfragen der elektronischen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Marktstrukturprobleme (schwer zu duplizierende Infrastruktur als „essential facility“ in Händen<br />
des Incumbent) oftmals – nach teils langwierigen Verfahren – nicht mehr rückgängig<br />
gemacht werden kann. Eine Vorabregulierung wird zudem in jenen Fällen geeigneter sein, in<br />
denen zur Behebung des Wettbewerbsproblems zahlreiche Anfor<strong>der</strong>ungen nötig sind (detaillierte<br />
Buchhaltung, Kostenrechnung, generelles Monitoring) o<strong>der</strong> aber wenn etwa ein häufiges<br />
und/o<strong>der</strong> frühzeitiges Einschreiten unerlässlich ist.<br />
An<strong>der</strong>erseits ist <strong>für</strong> den entry-lag (Zeitverzögerung des Markteintritts) auf Seiten <strong>der</strong> Wettbewerber<br />
durchaus mit einer signifikanten Zeitspanne zu rechnen. Diese kann entstehen durch<br />
die Bereitstellung <strong>der</strong> <strong>für</strong> einen Verbindungsnetzbetrieb nötigen Netzelemente, die erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Verhandlungsprozesse (Zusammenschaltungsvereinbarungen), die Erreichung eines<br />
hinreichend großen Bekanntheitsgrades, die Bereitstellung entsprechen<strong>der</strong> customer care<br />
sowie Billing-Einrichtungen, den Abschluss von Verträgen mit internationalen Carriern und<br />
die vielfältigen Verzögerungsmöglichkeiten des Incumbents, <strong>der</strong> eben in Bezug auf den inländischen<br />
Teil <strong>der</strong> Verkehrsführung im Besitz <strong>der</strong> nicht ersetzbaren Infrastruktur im Anschlussbereich<br />
ist (ON 25). In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in an<strong>der</strong>en<br />
Industriezweigen ein Markteintritt eines Mitbewerbers oft erst mittelbar über die Marktbeobachtung<br />
feststellbar ist, im vorliegenden Markt jedoch auf Grund <strong>der</strong> Zusammenschaltung<br />
(Vorleistungsabhängigkeit) unmittelbar noch vor dem Markteintritt bekannt wird, und die<br />
Chance auf eine „hit and run“-Strategie schon im Ansatz zum Scheitern verurteilt ist.<br />
Ist nun aber Annahme 2 nicht bzw. nicht annähernd gegeben, so kommt es <strong>für</strong> die Entscheidung<br />
über einen allfälligen Markteintritt nicht mehr primär auf die gegenwärtigen Preise an,<br />
als vielmehr auf die im Falle eines erfolgten Marktzutritts und nach etwaigen preislichen Reaktionen<br />
<strong>der</strong> bereits am Markt etablierten Anbieter noch realisierbaren Preise und Gewinne.<br />
Bei ständigen Marktein- und austritten käme es zudem zu einer erheblichen Verunsicherung<br />
<strong>der</strong> Konsumenten gegenüber Angeboten alternativer Betreiber. Effektiver Wettbewerb, <strong>der</strong><br />
von <strong>der</strong> bloßen Drohung potentieller Konkurrenz ausgehen soll, erscheint unter diesen Bedingungen<br />
als eine unrealistische Annahme.<br />
Da diese Modellkritik mittlerweile auch überwiegend von <strong>der</strong> einschlägigen industrie- und<br />
wettbewerbsökonomischen Literatur geteilt wird (inter alia George et al. (2000), S. 279ff. und<br />
Borrmann/Finsinger (1999), S. 301ff. aber auch Tirole (2000), Armstrong et al. (1998), S.<br />
103ff., Viscusi et al. (2000), S. 161), ist dieses Modell als politisches Leitbild zur Beurteilung<br />
von Marktmacht auf Kommunikationsmärkten heute nur mehr von geringer Relevanz.<br />
In engem Kontext zur Bestreitbarkeit von Märkten steht die Frage nach <strong>der</strong> unternehmerischen<br />
Rationalität von Verdrängungspreisstrategien („predatory pricing“). Denn je höher die<br />
bereits getätigten versunkenen Investitionen alternativer Wettbewerber ausfallen, desto höher<br />
werden auch die potentiellen Marktaustrittskosten, was die Erfolgsaussichten von Verdrängungsstrategien<br />
wie<strong>der</strong>um min<strong>der</strong>t. Insofern würden Investitionen in die<br />
Infrastruktur, soweit diese eben ökonomisch sinnvoll getätigt werden können, die Notwendigkeit<br />
von regulatorischer Basisregulierung reduzieren.<br />
Insgesamt kann daher auf das Funktionieren <strong>der</strong> Bestreitbarkeit bzw. auf die disziplinierenden<br />
Effekte <strong>der</strong> potentiellen Konkurrenz nicht vertraut werden, die Marktbarrieren sind daher<br />
auch auf dem gegenständlichen Markt nicht vernachlässigbar. So stünde potentielle Konkurrenz<br />
insbeson<strong>der</strong>e auch in Wi<strong>der</strong>spruch mit dem nach wie vor jedenfalls in Ausschnitten zugunsten<br />
<strong>der</strong> Telekom Austria existierenden höheren Preisniveau.<br />
2.1.4. Preise<br />
Das Verhalten am Markt umfasst auch die Preissetzungspolitik eines Unternehmens. Die<br />
Preissetzungspolitik eines Unternehmens ist ein wesentlicher ökonomischer Verhaltensparameter<br />
und kann daher auch <strong>für</strong> die Beurteilung von Marktmacht relevant sein. So geben zB<br />
Preisbewegungen im Zeitverlauf, vorhandene Preisdifferentiale zwischen einzelnen Betrei-<br />
11<br />
<strong>Vorlesung</strong>smaterialien Seite 147