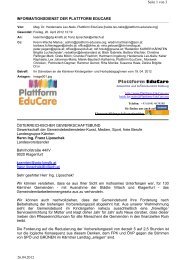Bewegung als begleitende Intervention bei kindlicher Legasthenie ...
Bewegung als begleitende Intervention bei kindlicher Legasthenie ...
Bewegung als begleitende Intervention bei kindlicher Legasthenie ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Person, die sich mit dem Begriff „Selbstkonzept“ fassen lassen.“ (ZIMMER 1999, S.51)<br />
Beim Selbstkonzept spielen auch Gefühle und andere unbewusste Parameter eine Rolle. Man<br />
kann sich am Montag super fühlen und am Dienstag fühle ich mich wie ein totaler Versager.<br />
Im Volksmund wird dies oft auch <strong>als</strong> "Tagesverfassung“ bezeichnet. Das Selbstkonzept zeigt<br />
demnach Schwankungen, der eine tiefere Ursache zugrunde liegt.<br />
Körperschema und Körperbild: Das Konzept des Körperschemas wurde von der klinischen<br />
und experimentellen Neurologie entwickelt. In der Folgezeit erfuhr es durch eine Fülle<br />
psychiatrischer und allgemeinpsychologischer Theoriebildungen eine erhebliche Erweiterung.<br />
Der Begriff „Körperschema“ wurde 1980 von PICK eingeführt. Er betonte, dass es mehrere<br />
Körperschemata für jede sensible Qualität des Körpers gibt. Unter ihnen soll das „optische<br />
Vorstellungsbild“ das wesentliche Gerüst für das Bewusstsein unserer Körperlichkeit bilden.<br />
Es ist das Konzept, der sich im Laufe des Lebens durch sensorische Information bildenden<br />
Raumbilder des Körpers, das PICK <strong>als</strong> Grundlage für die Erklärung klinischer Beobachtungen<br />
dient. (vgl. JORASCHKY 1983, S.17)<br />
EGGERT bezeichnet das Körperschema auch <strong>als</strong> „Bewusstsein des eigenen Körpers aufgrund<br />
multipler sensorischer Wahrnehmung zustande gekommener kognitiver Prozess“. (1997,<br />
S.87)<br />
P.F. SCHILDER unterschied in seinem Buch „The image and the appearance of the human<br />
body“, das 1935 in London und 1950 in New York erschien, zwischen Körperschema und<br />
Körperbild. Beide Begriffe wurden mit der Zeit weiter ausgear<strong>bei</strong>tet. „Das Körperschema ist<br />
die gefühlssichere Vorstellung von Körpergrenzen und Größenrelationen der Körperteile<br />
zueinander und zur Umgebung, die sichere Vorstellung vom Organismus <strong>als</strong> physikalischem<br />
Körper.“ (aus http://www.dpg-psa.de/an_ps_historie_05.htm)<br />
Letzteres gilt jedoch nur <strong>bei</strong> einem vollkommen entwickelten Körperschema. Abweichungen<br />
finden sich <strong>bei</strong> Entwicklungsverzögerungen oder wenn andere Störungen, z.B. neurologische<br />
Störungen, auftreten. Die einfachste Beeinflussung liegt zum Beispiel unter Stress vor. Steht<br />
der Mensch unter starker psychischer Belastung, kann es schnell einmal passieren, dass er<br />
sich an einem Türrahmen stößt, jemanden auf der Straße anrempelt, oder gegen eine<br />
Tischkante rennt. Es ist dies eine Folge einer momentanen Störung des Körperschemas durch<br />
Überforderung. Dem folgt auch die Redewendung: „Heute stehe ich irgendwie neben mir.“<br />
Sie bezeichnet eine vorübergehende Irritation der Orientierung über die einzelnen Körperteile,<br />
19