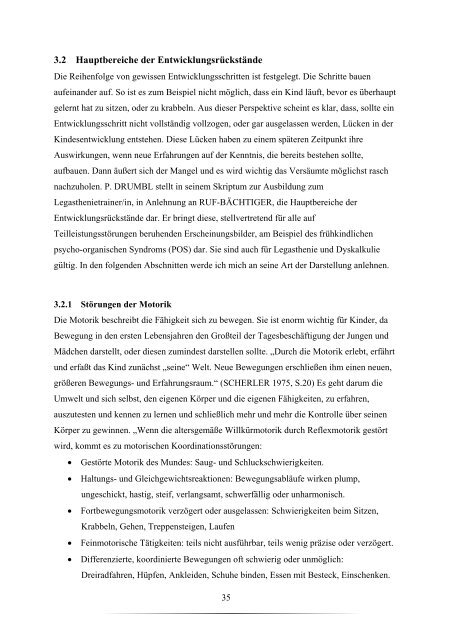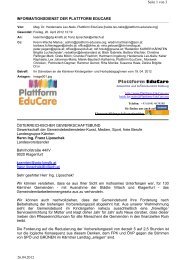Bewegung als begleitende Intervention bei kindlicher Legasthenie ...
Bewegung als begleitende Intervention bei kindlicher Legasthenie ...
Bewegung als begleitende Intervention bei kindlicher Legasthenie ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.2 Hauptbereiche der Entwicklungsrückstände<br />
Die Reihenfolge von gewissen Entwicklungsschritten ist festgelegt. Die Schritte bauen<br />
aufeinander auf. So ist es zum Beispiel nicht möglich, dass ein Kind läuft, bevor es überhaupt<br />
gelernt hat zu sitzen, oder zu krabbeln. Aus dieser Perspektive scheint es klar, dass, sollte ein<br />
Entwicklungsschritt nicht vollständig vollzogen, oder gar ausgelassen werden, Lücken in der<br />
Kindesentwicklung entstehen. Diese Lücken haben zu einem späteren Zeitpunkt ihre<br />
Auswirkungen, wenn neue Erfahrungen auf der Kenntnis, die bereits bestehen sollte,<br />
aufbauen. Dann äußert sich der Mangel und es wird wichtig das Versäumte möglichst rasch<br />
nachzuholen. P. DRUMBL stellt in seinem Skriptum zur Ausbildung zum<br />
<strong>Legasthenie</strong>trainer/in, in Anlehnung an RUF-BÄCHTIGER, die Hauptbereiche der<br />
Entwicklungsrückstände dar. Er bringt diese, stellvertretend für alle auf<br />
Teilleistungsstörungen beruhenden Erscheinungsbilder, am Beispiel des frühkindlichen<br />
psycho-organischen Syndroms (POS) dar. Sie sind auch für <strong>Legasthenie</strong> und Dyskalkulie<br />
gültig. In den folgenden Abschnitten werde ich mich an seine Art der Darstellung anlehnen.<br />
3.2.1 Störungen der Motorik<br />
Die Motorik beschreibt die Fähigkeit sich zu bewegen. Sie ist enorm wichtig für Kinder, da<br />
<strong>Bewegung</strong> in den ersten Lebensjahren den Großteil der Tagesbeschäftigung der Jungen und<br />
Mädchen darstellt, oder diesen zumindest darstellen sollte. „Durch die Motorik erlebt, erfährt<br />
und erfaßt das Kind zunächst „seine“ Welt. Neue <strong>Bewegung</strong>en erschließen ihm einen neuen,<br />
größeren <strong>Bewegung</strong>s- und Erfahrungsraum.“ (SCHERLER 1975, S.20) Es geht darum die<br />
Umwelt und sich selbst, den eigenen Körper und die eigenen Fähigkeiten, zu erfahren,<br />
auszutesten und kennen zu lernen und schließlich mehr und mehr die Kontrolle über seinen<br />
Körper zu gewinnen. „Wenn die altersgemäße Willkürmotorik durch Reflexmotorik gestört<br />
wird, kommt es zu motorischen Koordinationsstörungen:<br />
• Gestörte Motorik des Mundes: Saug- und Schluckschwierigkeiten.<br />
• Haltungs- und Gleichgewichtsreaktionen: <strong>Bewegung</strong>sabläufe wirken plump,<br />
ungeschickt, hastig, steif, verlangsamt, schwerfällig oder unharmonisch.<br />
• Fortbewegungsmotorik verzögert oder ausgelassen: Schwierigkeiten <strong>bei</strong>m Sitzen,<br />
Krabbeln, Gehen, Treppensteigen, Laufen<br />
• Feinmotorische Tätigkeiten: teils nicht ausführbar, teils wenig präzise oder verzögert.<br />
• Differenzierte, koordinierte <strong>Bewegung</strong>en oft schwierig oder unmöglich:<br />
Dreiradfahren, Hüpfen, Ankleiden, Schuhe binden, Essen mit Besteck, Einschenken.<br />
35