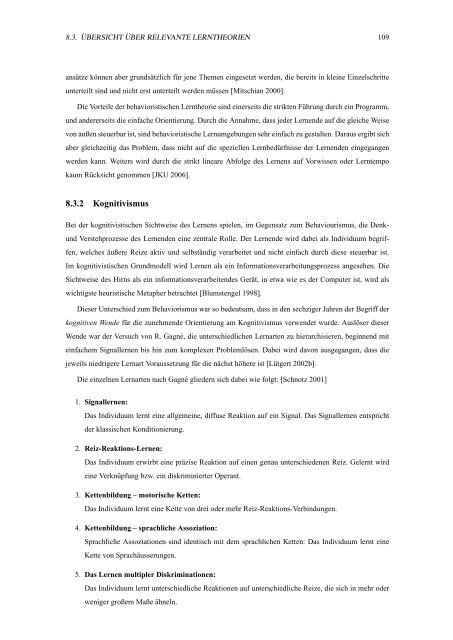Journal of Applied Knowledge Management - Felix Moedritscher
Journal of Applied Knowledge Management - Felix Moedritscher
Journal of Applied Knowledge Management - Felix Moedritscher
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8.3. ÜBERSICHT ÜBER RELEVANTE LERNTHEORIEN 109<br />
ansätze können aber grundsätzlich für jene Themen eingesetzt werden, die bereits in kleine Einzelschritte<br />
unterteilt sind und nicht erst unterteilt werden müssen [Mitschian 2000].<br />
Die Vorteile der behavioristischen Lerntheorie sind einerseits die strikten Führung durch ein Programm,<br />
und andererseits die einfache Orientierung. Durch die Annahme, dass jeder Lernende auf die gleiche Weise<br />
von außen steuerbar ist, sind behavioristische Lernumgebungen sehr einfach zu gestalten. Daraus ergibt sich<br />
aber gleichzeitig das Problem, dass nicht auf die speziellen Lernbedürfnisse der Lernenden eingegangen<br />
werden kann. Weiters wird durch die strikt lineare Abfolge des Lernens auf Vorwissen oder Lerntempo<br />
kaum Rücksicht genommen [JKU 2006].<br />
8.3.2 Kognitivismus<br />
Bei der kognitivistischen Sichtweise des Lernens spielen, im Gegensatz zum Behaviourismus, die Denkund<br />
Verstehprozesse des Lernenden eine zentrale Rolle. Der Lernende wird dabei als Individuum begriffen,<br />
welches äußere Reize aktiv und selbständig verarbeitet und nicht einfach durch diese steuerbar ist.<br />
Im kognitivistischen Grundmodell wird Lernen als ein Informationsverarbeitungsprozess angesehen. Die<br />
Sichtweise des Hirns als ein informationsverarbeitendes Gerät, in etwa wie es der Computer ist, wird als<br />
wichtigste heuristische Metapher betrachtet [Blumstengel 1998].<br />
Dieser Unterschied zum Behaviorismus war so bedeutsam, dass in den sechziger Jahren der Begriff der<br />
kognitiven Wende für die zunehmende Orientierung am Kognitivismus verwendet wurde. Auslöser dieser<br />
Wende war der Versuch von R. Gagné, die unterschiedlichen Lernarten zu hierarchisieren, beginnend mit<br />
einfachem Signallernen bis hin zum komplexen Problemlösen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die<br />
jeweils niedrigere Lernart Voraussetzung für die nächst höhere ist [Lütgert 2002b].<br />
Die einzelnen Lernarten nach Gagné gliedern sich dabei wie folgt: [Schnotz 2001]<br />
1. Signallernen:<br />
Das Individuum lernt eine allgemeine, diffuse Reaktion auf ein Signal. Das Signallernen entspricht<br />
der klassischen Konditionierung.<br />
2. Reiz-Reaktions-Lernen:<br />
Das Individuum erwirbt eine präzise Reaktion auf einen genau unterschiedenen Reiz. Gelernt wird<br />
eine Verknüpfung bzw. ein diskriminierter Operant.<br />
3. Kettenbildung – motorische Ketten:<br />
Das Individuum lernt eine Kette von drei oder mehr Reiz-Reaktions-Verbindungen.<br />
4. Kettenbildung – sprachliche Assoziation:<br />
Sprachliche Assoziationen sind identisch mit dem sprachlichen Ketten: Das Individuum lernt eine<br />
Kette von Sprachäusserungen.<br />
5. Das Lernen multipler Diskriminationen:<br />
Das Individuum lernt unterschiedliche Reaktionen auf unterschiedliche Reize, die sich in mehr oder<br />
weniger großem Maße ähneln.